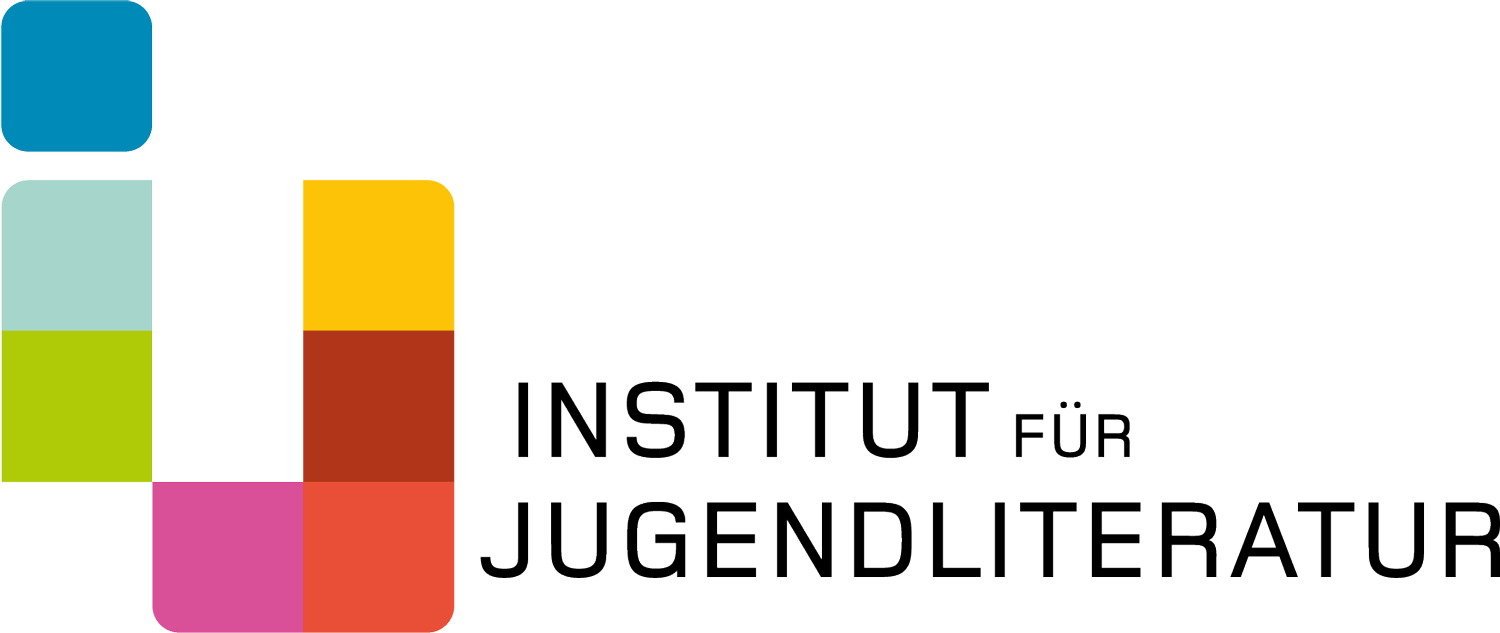Cristina Moracho: Zwillingsterne
Seelenverwandte im Amerika der 90er Jahre
Hamburg: Königskinder im Verlag Carlsen 2014
Castor und Pollux, die am nächtlichen Himmel das Zwillingssternbild schlechthin verkörpern, wurden laut der griechischen Sage von Zeus in derselben Nacht gezeugt. Im Amerika Mitte der 90er Jahre führt eine weniger göttliche Fügung dazu, dass zwei Kinder zu Seelenverwandten werden: Der Babysitter sagt ab, und eine alleinerziehende Mutter bringt ihren kleinen Sohn bei einem Nachbarn unter – schließlich hat der eine gleichaltrige Tochter. Dieser Abend bezeichnet die Geburt der Zwillingssterne Althea und Oliver, die dem Debutroman von Cristina Moracho seinen Namen geben.
Seit nunmehr zehn Jahren sind sie unzertrennlich, verbringen jede freie Minute zusammen. Wo der eine ist, geht auch der andere hin. Und dann, als sie sechzehn werden, beginnt sich alles zu verändern. Althea will mehr als nur eine platonische Freundschaft. Oliver spürt zwar, dass er nicht so empfindet, kann sich aber nicht dazu durchringen, Klartext zu reden. Einerseits weil er selbst nicht so genau weiß, was Sache ist, andererseits, weil er die enge Bindung zwischen ihnen nicht gefährden will. Mitten im schmerzhaft-komplizierten Wechsel zwischen Distanz und Nähe, Zurückweisung und Leidenschaft erkrankt Oliver. Zunächst weiß keiner, weshalb er dieses ungeheure, mehrere Wochen andauernde Schlafbedürfnis hat. Und wenn er kurz daraus aufwacht, ist er nicht er selbst, sondern asozial und aggressiv, heißhungrig auf Essen und auf Sex. Er leidet am seltenen Kleine – Levin-Syndrom. Unheilbar.
Oliver wünscht sich nichts sosehr, als dass alles wieder „normal“ wird, so wie früher. Althea wünscht sich, dass sich alles weiterentwickelt, dass er ihre Liebe erwidert. So prallen die Zwillingssterne aufeinander. Haben Sex, in einer von Olivers Wachphasen, an die er sich danach nicht erinnern kann. Verletzen einander so tief, wie man sich nur verletzen kann, wenn man sich sehr nahe ist.
Zu nahe - sie driften auseinander. Oliver geht nach New York in ein Schlaflabor, wo seine Krankheit untersucht werden soll. Althea folgt ihm, um den Bruch ungeschehen zu machen, doch sie kommt zu spät. Er ist bereits wieder in einer Schlafphase.
Ziel- und orientierungslos, in jeder Hinsicht am Ende, landet Althea bei einer Gruppe junger Aussteiger, die zusammen in einem chaotisch-kreativen Haus leben. Sie nehmen das Mädchen bei sich auf, akzeptieren sie so, wie sie ist. Dort gelingt es ihr erstmals, Freundschaften zu schließen, dort hat sie eine Chance, über Oliver hinweg zu kommen.
Der wacht wieder auf, sucht Althea und findet sie auch. In einem Hollywood-Film gäbe es jetzt ein gemeinsames Happy End. Nicht so bei Cristina Moracho.
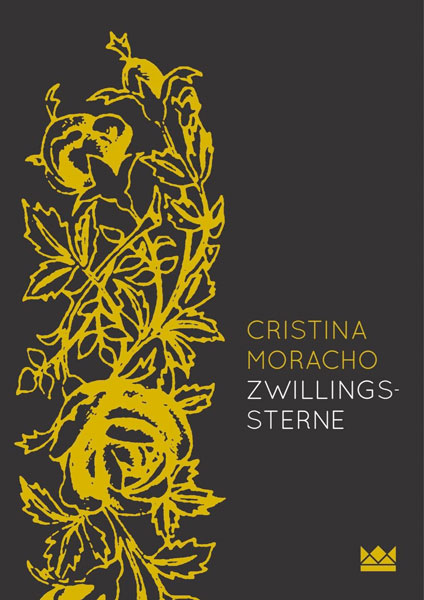
Auch wenn es kein gemeinsames Happy End ist, es ist ein kein trauriges Ende. Oliver kann Altheas Liebe zwar nicht erwidern, aber der Text legt deutliche Spuren, dass eine andere Liebe auf sie wartet. Olivers Krankheit ist zwar nicht heilbar, aber er hat den festen Willen, dagegen anzukämpfen, auch mit Hilfe von Medikamenten: „Er will sehen, was da draußen noch auf ihn wartet“. Das gilt für beide. Ihr Weg ist kein hoffnungsloser, auch wenn oder gerade weil er ins Unbekannte führt. Althea konnte sich aus der emotionalen Abhängigkeit von Oliver befreien, hat ihre Wahlverwandtschaften gefunden und so ihre Welt erweitert. Und Oliver hat seine Sehnsucht nach Unveränderlichkeit überwunden und gelernt, Unsicherheit anzunehmen. Auch das eine Form von Horizonterweiterung.
„Hätte er sie so lieben können, wie sie ihn liebt, wäre alles anders gekommen, dann würde das Universum immer noch aus einem einzigen Sternbild bestehen.“ Dass das Universum für Althea und Oliver mehr als nur Castor und Pollux bereit hält, hat nichts Trauriges an sich. Eigentlich im Gegenteil.