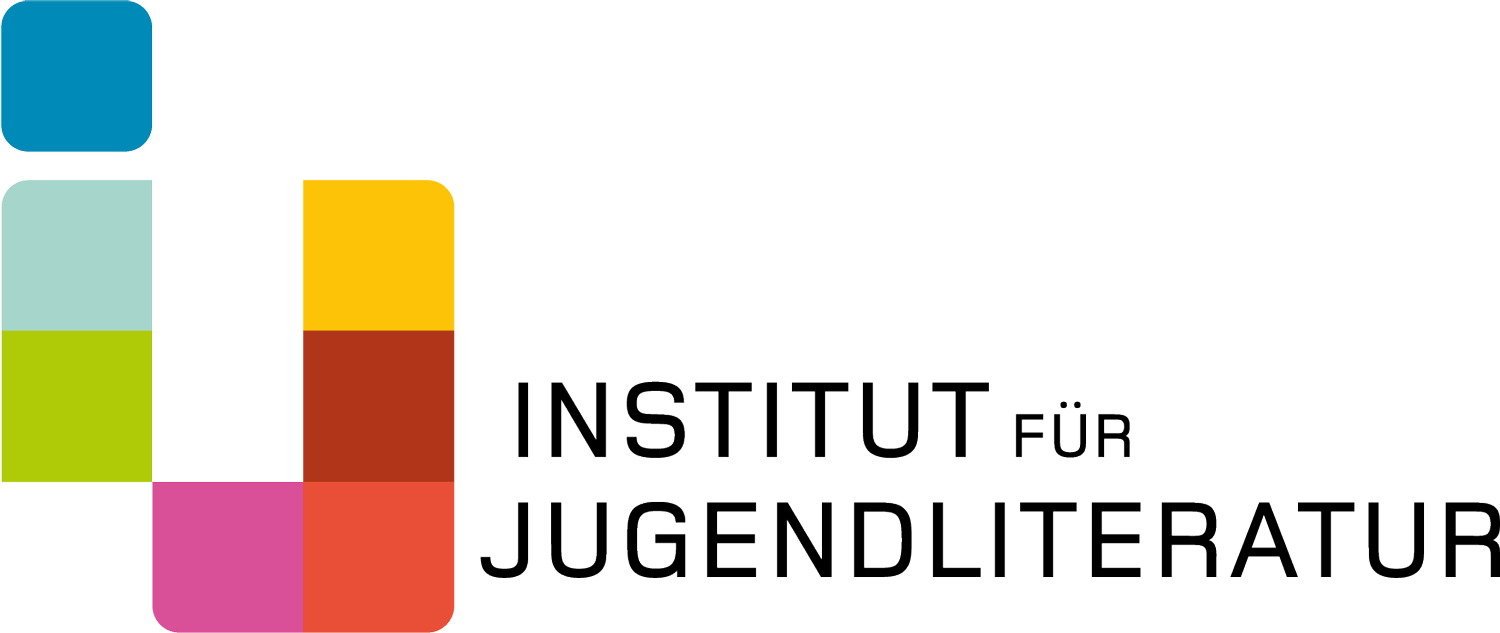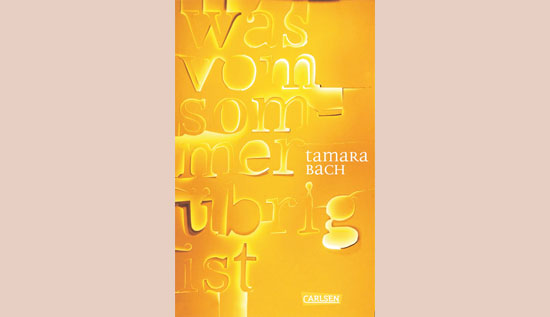
Tamara Bach: Was vom Sommer übrig ist
„Und irgendwann gibt es nur noch einen selbst“. Die beiden Ich-Erzählerinnen Louise und Jana in Tamara Bachs neuem Jugendroman „was vom Sommer übrig ist“ haben niemanden, mit dem sie reden, lachen, weinen könnten. Keine Freunde, keine Verwandten – und die Eltern, die sind ausschließlich mit sich selbst beschäftigt.
„Und irgendwann gibt es nur noch einen selbst“. Die beiden Ich-Erzählerinnen Louise und Jana in Tamara Bachs neuem Jugendroman „was vom Sommer übrig ist“ haben niemanden, mit dem sie reden, lachen, weinen könnten. Keine Freunde, keine Verwandten – und die Eltern, die sind ausschließlich mit sich selbst beschäftigt.
Angesichts der Tragödie, die sich in Janas Leben abgespielt hat – ihr älterer Bruder liegt nach einem Selbstmordversuch im Koma – vergessen ihre frisch getrennten Eltern darauf, dass sie noch eine Tochter haben, vergessen ihren Geburtstag, ihre Existenz. Und Mutter und Vater von Louise, überarbeitet und immer müde, haben „Hornhaut auf den Ohren und auf den Augen“, man sieht sich nicht, sogar wenn man im selben Raum ist. Es ist still in diesen Häusern, sehr still. Hier sind sich Eltern und Kinder so fremd, dass es einem beim Lesen wehtut, hier wird Kindheit und Jugend nur verwaltet, nicht begleitet, geschweige denn verstanden.
Der Text steigt mit dem letzten Schultag aus der Perspektive der siebzehnjährigen Louise ein. Sie war nicht immer Einzelgängerin, doch irgendwie sind die Dinge blöd gelaufen, seit Paul sich von ihr abgewandt hat, obwohl sie doch Freunde waren: „Manchmal schwingt der Wind einfach um“.
Louise nimmt, weil sie ohnehin nichts anderes vorhat, gleich drei Jobs an. Frühmorgens Zeitungaustragen, ab halb sechs in der Bäckerei aushelfen, sich zwischendurch um den Hund der verreisten Oma kümmern. Und für den Führerschein lernen. „Alles nur eine Frage der Planung.“ Und dann begegnet sie Jana, die – vier Jahre jünger – bei der älteren geradezu offensiv Anschluss sucht. Louise, die keine Ahnung von Janas familiärer Tragödie hat, weist das Mädchen zunächst brüsk zurück. Bis zu dem Tag, an dem ihr verbissen aufrecht erhaltenes Gebäude aus Organisation und äußerlichem Funktionieren zusammen bricht – Louise fällt durch die Theorieprüfung. Ein Ding der Unmöglichkeit, sie ist noch nie durchgefallen, sie ist niemand, der durchfällt. Als dann auch noch ihre Mitschülerin Constanze auftaucht, die mal was mit Paul hatte, bricht sie aus, schnappt sich Jana und den Hund und packt sie ins Auto ihrer Großmutter.
Und dann fahren sie los ins Blaue, und tun so als ob. Als ob ihr Leben anders wäre. Sich was wünschen, bis einem nichts mehr einfällt. Dreihundert Arten des Lachens lachen. Nur für einen Tag und eine Nacht – und am nächsten Morgen ist es vorbei.
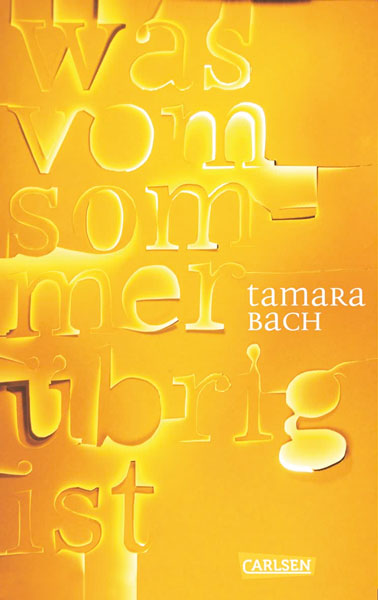
Danach zieht sich Jana in völlige Isolation zurück: „Ich bin nicht hier“. Nur Louise dringt irgendwann zu ihr durch, holt sie ab, geht mit ihr los. Was vom Sommer übrig ist, ist eine beginnende Freundschaft, mit der sich Unerträgliches vielleicht ein klein wenig leichter ertragen lässt.
Die schon für ihren Erstling „Marsmädchen“ 2004 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnete Berliner Autorin ist hier erneut stilistisch auf dem Punkt. Da ist kein Wort zu viel, kein Bild schief, und welche Perspektive, Louises oder Janas, für welchen Teil der Geschichte gewählt wird, ist sehr durchdacht. Da wird mit musikalisch anmutendem Rhythmusgefühl auf den Sprachklang geachtet, der in unterschiedlichen Geschwindigkeiten fließt, sich genau seinen Figuren anpasst. Und die beiden Sprecherinnen kommen einem extrem nahe – in all ihrer Unterschiedlichkeit. Wunderbar auch, wie sich die Charaktere im Laufe der Erzählung und der Beziehung zueinander verändern. Wie Louise, die sich in ihrem durchorganisierten Perfektionismus geradezu eingemauert hat, dann am Ende die Jüngere an der Hand nimmt. Wie Jana zunächst versucht, der Einsamkeit mit naiv-spontanen nächtlichen Ausflügen davonzulaufen, die Angst um den Bruder weg zu reden, mit kleinen Lügen oder Dauerquasseln. Bis es nicht mehr geht und sie sich nach Toms Tod wie im Krieg fühlt, wie „ im Auge des Sturms.“ Und bewegungslos verstummt.
Nicht nur die Figuren haben verschiedene farbliche Schattierungen, auch der Tonfall des Textes changiert, ist mal episch bilderreich, mal flapsig. Manchmal, selten, muss man grinsen wie etwa über den doofen kurzbeinigen Hund, der als Nebenfigur übrigens die beiden Mädchen zusammenbringt. Und manchmal muss man möglicherweise sogar weinen.
Ein sehr schönes, intensives, berührendes Buch. Das einem mal wieder nachdrücklich vor Augen führt, wie wichtig es ist, dass es eben nicht nur einen selbst gibt.