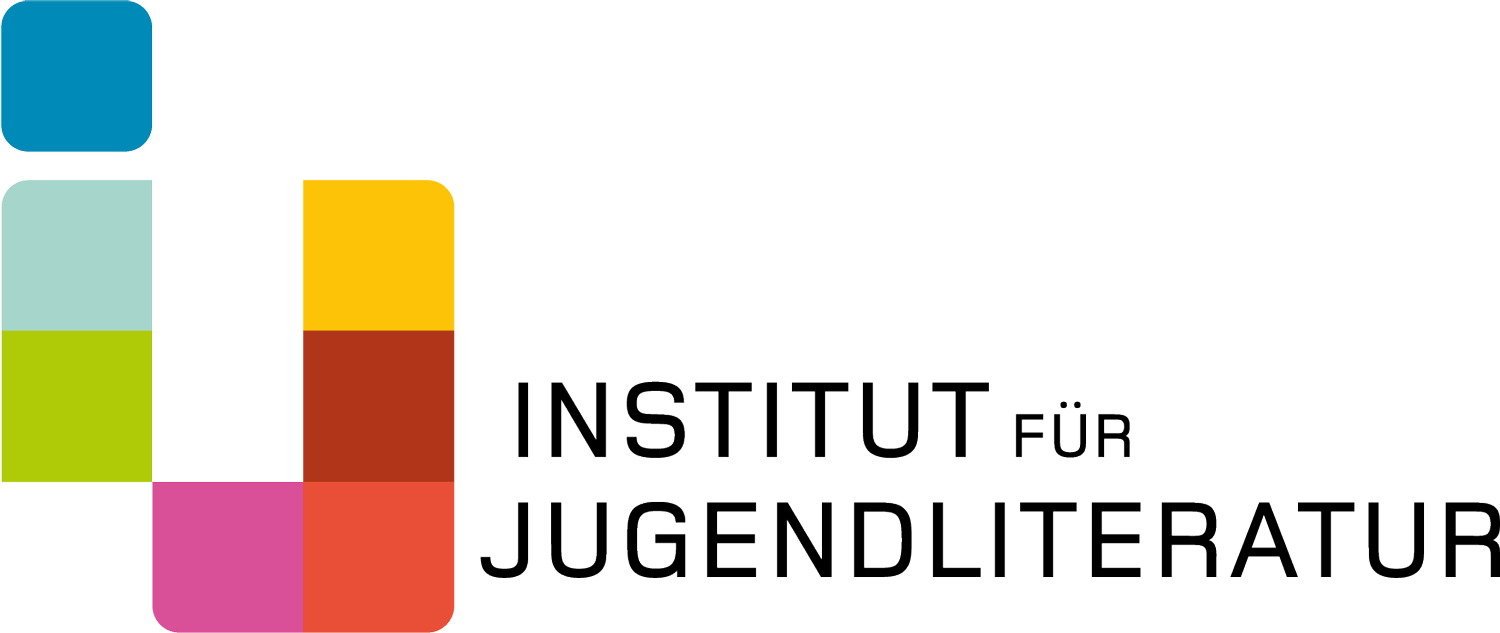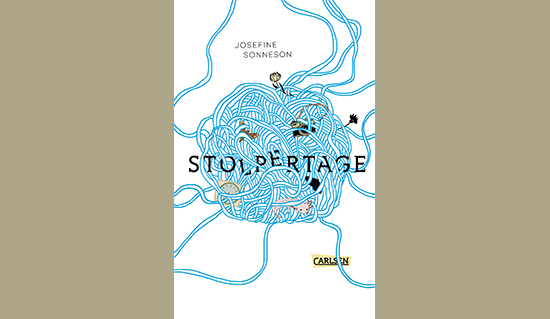
Josefine Sonneson: Stolpertage
Erinnerungen bleiben länger erhalten, wenn starke Emotionen beteiligt sind, perfiderweise vor allem die negativen. Zumindest in jungen Jahren, im Alter ändert sich das wieder, aber in Stein gemeißelt ist das alles auch nicht. Sicher ist nur, dass Erinnerungen subjektiv sind. „Vielleicht haben alle ihre eigenen aufbewahrten Erinnerungen, die bei anderen schon aussortiert wurden.“ überlegt die dreizehnjährige Ich-Erzählerin Jette in Josefine Sonnesons Debütroman „Stolpertage“.
Das Mädchen muss sich mehr mit dem Thema Loslassen beschäftigen, als ihr lieb ist: Nach der Trennung ist der Vater nicht mehr da, irgendwann gibt es Hannes, einen neuen Mann in Mutters Leben, ihre beste Freundin zieht in eine andere Stadt, ihr Großvater verändert sich durch seine Demenz immer mehr. Und jetzt steht ein besonders schmerzhafter Bruch bevor: Sie muss das Haus mit dem wunderschönen Garten verlassen, in dem sie aufgewachsen ist. Es ist zu teuer geworden, und die große Schwester wird nach dem Abitur auch nicht mehr ewig bei ihnen sein. Wenigstens wird es kein Hannes-Zimmer in der neuen Wohnung geben. Und als ob das nicht reichen würde, kommt ein noch viel einschneidender Abschied hinzu: Der Großvater stirbt, schläft im Pflegeheim friedlich ein, zwei Tage vor dem Umzug werden sie ihn begraben.
Für Jette geht das alles viel zu schnell: „Manchmal habe ich Angst, dass ich nicht begreife, dass sich etwas verändert hat, dass es schon lange vergangen ist und dass ich es nicht bemerkt habe.“ Und dabei will sie gar keine Veränderungen, möchte nicht loslassen, sondern festhalten. Jette bewahrt sogar die tote Motte auf, die sie aus Versehen umgebracht hat, trägt sie in einer leeren Überraschungsei-Dose mit sich herum: „Weil sich keine von uns dafür entschieden hat, dass alles einfach so passiert. Ohne Vorbereitung, ohne dass wir gefragt wurden.“
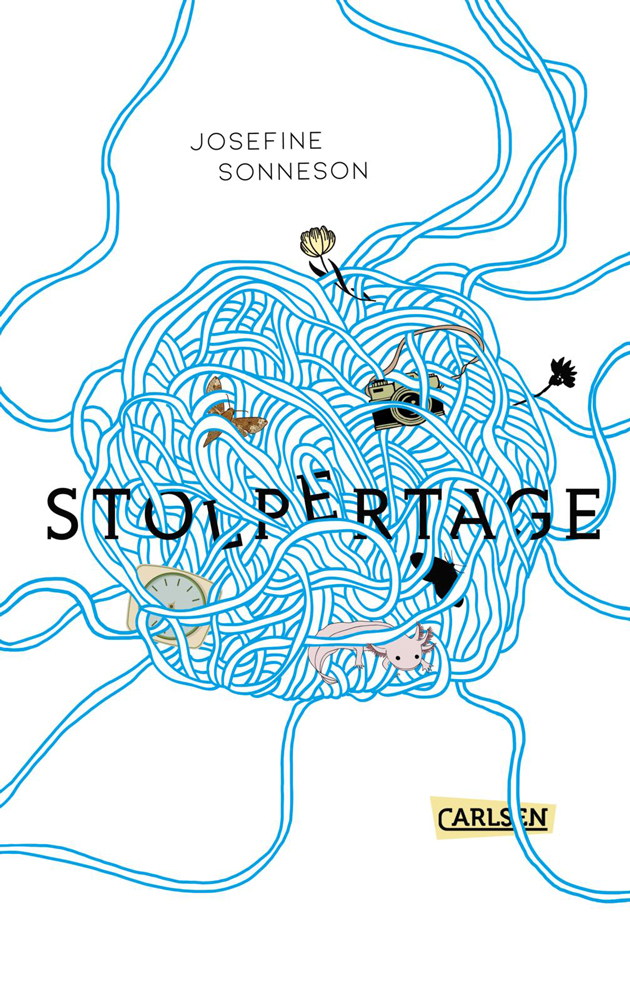
„Stolpertage“ ist ein ruhiger Text, in dem nicht viel passiert, nicht in der Schule und nicht zu Hause zwischen all den Umzugskisten. Man liest sich nicht aufgrund äußerer Spannungsmomente an dem Buch fest, sondern weil man emotional tief einsteigt in Jettes Leben, in ihre Beziehungen zur Mutter, zu Schulkameraden, und vor allem zur großen Schwester:
Emma ist verständnisvoller Rettungsanker, an den sich Jette anlehnen kann, und doch bei aller Nähe auch weit entfernt. Weil sie kurz vor dem Abitur und damit ohnedies vor einer einschneidenden Veränderung steht, macht ihr der Umzug viel weniger zu schaffen. „Die Schwester überschüttet mich mit ihrer Freude. Dann rauscht sie wieder weiter, ich sehe ihr nach. Nie wieder Schule, denke ich und wäre jetzt gerne da, wo sie ist.“
Wir lesen von alltäglichen wie außergewöhnlichen Situationen, von einer Familienfeier, einer Busfahrt, einem Besuch im Pflegeheim, und dann auch vom Sterben des Großvaters und seinem Begräbnis. Das alles ist voller Feingefühl erzählt, verdichtet in einer knappen Sprache, in der die Ich-Erzählerin beobachtet und beschreibt, ohne etwas analytisch auseinander zu erklären. Dabei durchbrechen immer wieder Jettes Erinnerungen die erzählte Gegenwart, die nur wenige Wochen umspannt, Erinnerungen an vergangene Erlebnisse mit denjenigen, die nicht mehr da sind: der nun vorwiegend abwesende Vater, die ehemalige Freundin, der Großvater. Akte des Bewahrens in einer Zeit, in der es Jette so vorkommt, als würde ihr ganzes Leben ungeplant und ungewollt einer Revision unterzogen. Als würden nicht nur die Umzugskisten aussortiert und durchgesehen werden müssen: „Was ich nicht unbedingt behalten will, wird weggeschmissen.“
Der Roman beschäftigt sich aus jugendlicher Perspektive mit der zeitlos relevanten Frage, wie man mit der Vergänglichkeit umgehen kann. Mit der Tatsache, dass sich manches nicht festhalten lässt, egal, wie sehr man es versucht. Eindeutige Antworten gibt das Buch natürlich nicht. Der Titel verweist darauf, dass manchmal alles gleichzeitig passiert und sich dann Dinge überschneiden, die eigentlich nicht zusammenpassen, und dann holpert es eben ziemlich:
„Ich habe jemanden sterben sehen und ich habe jetzt einen Toten gesehen. Und man kann auch lachen, obwohl man gleichzeitig traurig ist. Und man kann so hin und her stolpern zwischen allem.“ Stolpertage eben.