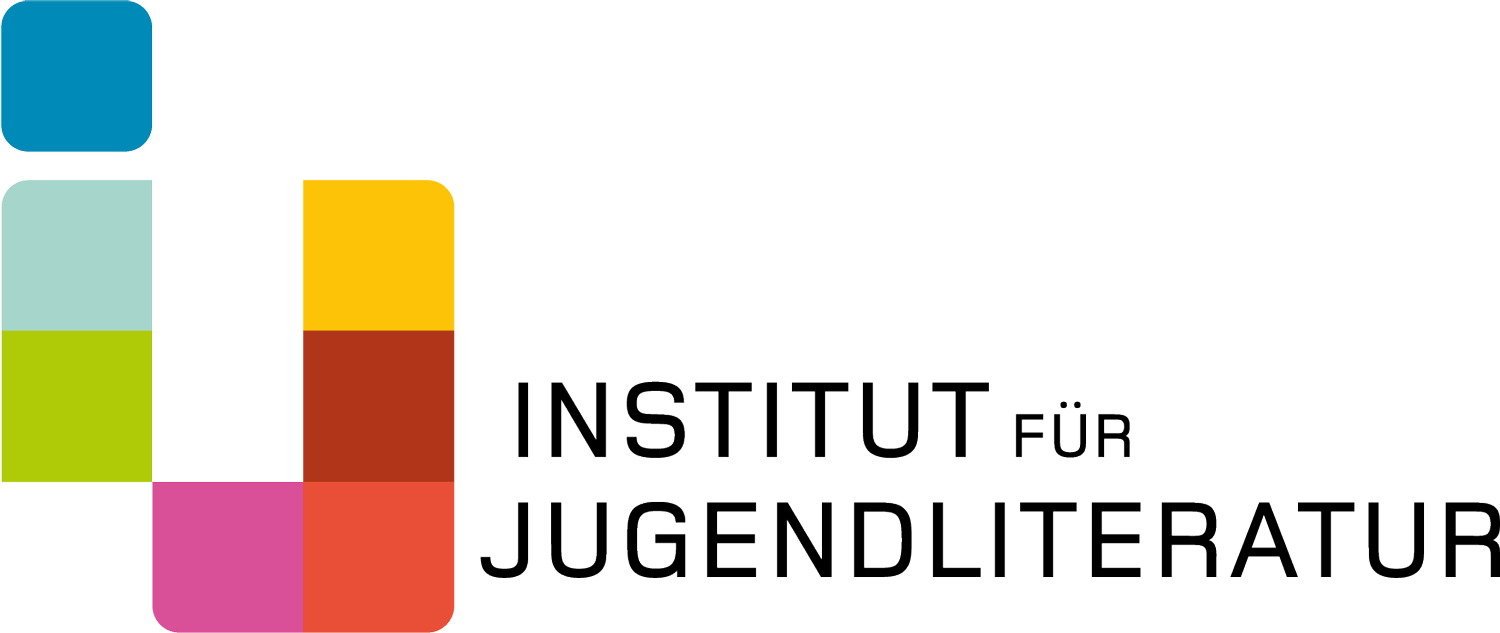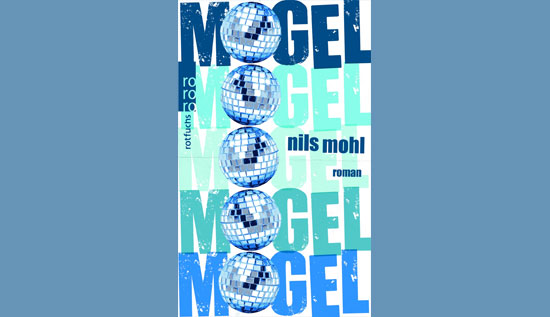
Nils Mohl: Mogel
Wenn ein Mann Frauenkleider trägt, tut er das wünschenswerterweise freiwillig. Nicht so Miguel, der 15-jährige Ich-Erzähler in Nils Mohls neuem Jugendroman „Mogel“. Weil er seinen Freunden alkoholfreies Bier vorgesetzt hat, muss er mit ihnen eine Nacht lang als Girlie verkleidet um die Häuser ziehen.
Wenn ein Mann Frauenkleider trägt, tut er das wünschenswerterweise freiwillig. Nicht so Miguel, der 15-jährige Ich-Erzähler in Nils Mohls neuem Jugendroman „Mogel“. Weil er seinen Freunden alkoholfreies Bier vorgesetzt hat, muss er mit ihnen eine Nacht lang als Girlie verkleidet um die Häuser ziehen. Zwei Mädels werden zur Unterstützung gerufen, und die Maskenbildnerinnen leisten ganze Arbeit: Aufgeschminkt bis zum Anschlag, in Shorts und Netzstrümpfen, ist Miguel so überzeugend, dass er nicht nur den Tankwart zum Sabbern bringt. In der Disco baggert ihn der einige Jahre ältere Aufreißer „Hengst“ mit dem „Flachlegerlächeln“ an, und zu seiner begeisterten Verwirrung kommt Miguel auch Candy näher, die er seit Längerem aus der Ferne ohne jede Aussicht auf Erfolg adoriert. Dabei stellt sich heraus, dass Candy nur noch mit Hengst zusammen ist, weil dieser etwas gegen sie in der Hand hat. Um ihr zu helfen, begibt sich Miguel, nach wie vor in seiner Pussy-Verkleidung, in eine ziemlich herausfordernde Situation …
Der Stoff gibt dem Autor natürlich massenhaft Anlässe für witzige Details, absurde Szenen und Situationskomik. „Mogel“ zu lesen ist richtig lustig. Aber nicht nur das. Der Text reflektiert durch die bruchlos subjektive Brille seines Ich-Erzählers bei allem Witz hintergründig auch über die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, über die Peinlichkeiten der Pubertät, über Freundschaft. Denn es ist nicht nur die Sache mit dem alkoholfreien Bier, für die Miguel büßen muss. Seit er vor einigen Wochen umgezogen ist, haben sich in die Beziehung zu seiner „Combo“, Silvester, Dimi und Flo da Ho, Anflüge von Entfremdung, ja sogar leiser Feindseligkeit eingeschlichen.
Die Jungs kennen sich, seit sie denken können, sind zusammen in einer Hochhaussiedlung am Stadtrand aufgewachsen. Jetzt wohnt Miguel mit seinen Eltern nach einer kleinen Erbschaft in einem Haus in der Vorstadtsiedlung und hat sogar ein eigenes Bad. Deshalb macht er auch den ganzen Zirkus mit, den die Combo mit ihm veranstaltet: Er will ihnen zeigen, dass er noch einer von ihnen ist. Das versucht er umso intensiver, als er irgendwie fühlt, dass er sich doch schon etwas von ihnen entfernt hat. Den Stadtrand vermisst er jedenfalls ganz bestimmt nicht, was deutlich wird, wenn er ihn beschreibt:
„In der Gegend hängt eine Menge Pack ab, muss man sagen. Die Bänke dort sind zum Beispiel Treffpunkt für die Muttis mit Kinderwagen, die es in ihren verlotterten Waben wohl nicht mehr aushalten und lieber die neuen Graffiti an den Müllcontainern studieren und eine Zippe nach der anderen löten. Die ganze Zeit blasen die den Qualm ihren Würmchen unter die Baldachine. Die Kleinen schreien in einer Tour, die Muttis sind genervt und barzen die nächste.“
Das ist das Ambiente, das wir schon aus Nils Mohls ersten beiden Bänden seiner Stadtrand-Saga, „Es war einmal Indianerland“ und „Stadtrandritter“, kennen. „Mogel“ spielt zwar im selben Milieu und einige Figuren tauchen auch in den anderen Büchern auf, es ist aber eine davon unabhängige Erzählung. In der die stilistischen Mittel fast noch konzentrierter eingesetzt werden: Norddeutsch gefärbte Jugendsprache ohne Zimperlichkeiten, Reflexionen, Emotionen und Ereignisdarstellungen als jugendliterarischer „stream of consciousness“, nicht-chronologisches Erzählen, das für Tempo und Spannung sorgt, dabei Beschränkung auf einen streng limitierten Zeitraum: Samstag, 18:02 bis Sonntag, 01:01.
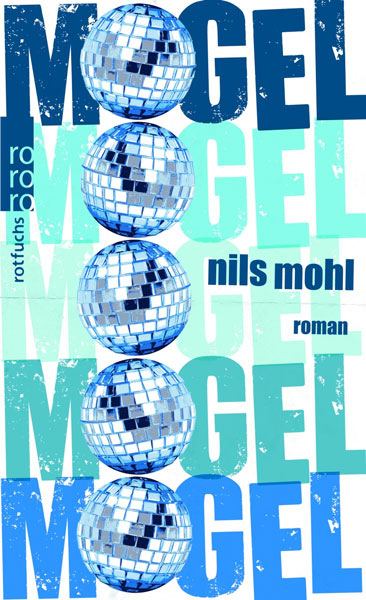
„Flo hält sich selbst für einen Typen, der sich beim Militär gut machen würde. Wobei du immer hoffen musst, dass das Militär ihn nicht nehmen wird. Weil, eines Tages kommt er sonst unter Garantie von einem Auslandseinsatz zurück und zeigt dir stolz eine Tüte voll Ohren. Oder so.“
Auch wenn Miguels Universum natürlich um sein eigenes Ego kreist – er weiß, dass seine Pubertätsnöte auch ihre burlesken Seiten haben: „Ich denke viel an Sex. Sex spielt eine große Rolle in meinem Leben. Wenn es nach mir geht, könnte die Sache sogar noch eine viel größere Rolle in meinem Leben spielen. Ich habe Sex nur mit mir selbst“. Da nimmt sich einer selbst nicht nur ernst. So wie Nils Mohl es sich auch gönnt, einfach nur zu blödeln. Etwa in der Vergabe von Eigennamen: Die Disco trägt den schönen Namen „ChackaBum“, der Antagonist heißt „Hengst“ und das begehrte Mädchen „Candy“. Das funktioniert gut in einem Schelmenroman, vor allem, wenn er so vielschichtig-doppelbödigen Witz hat wie „Mogel“.