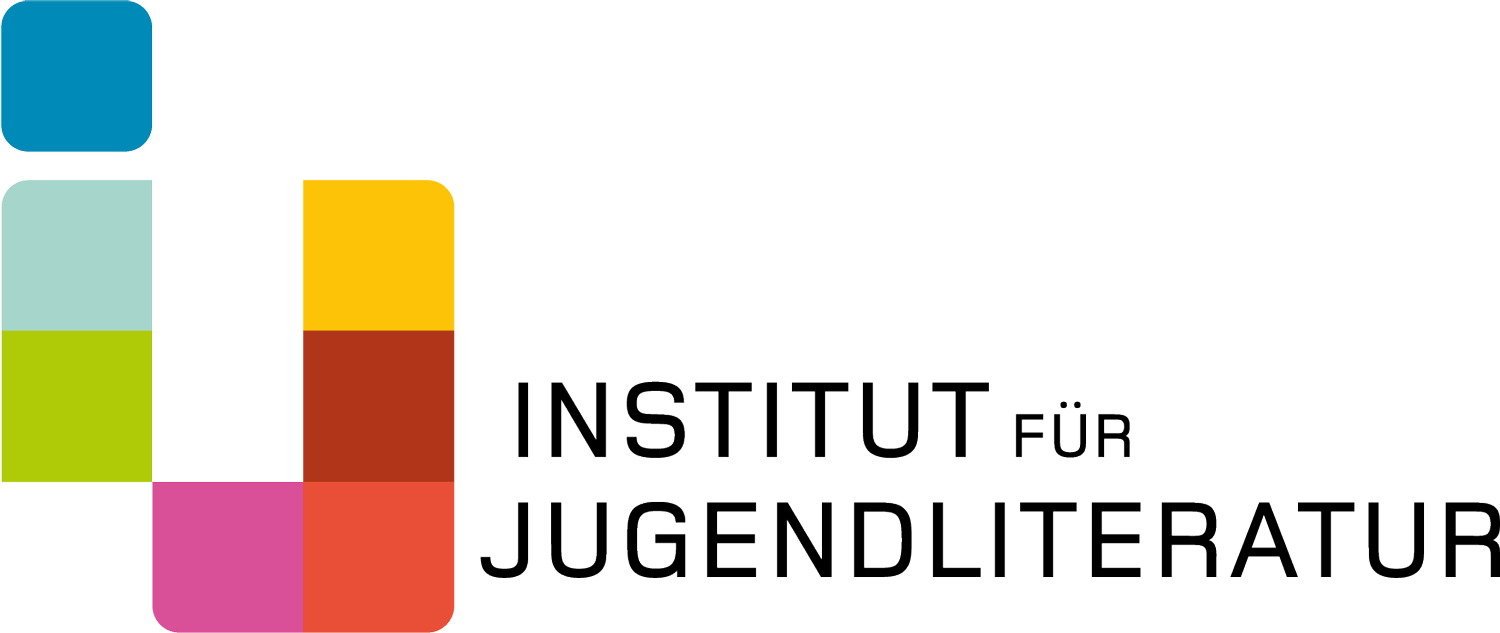Rachel van Kooij: Menschenfresser George
„Ich entschied, Japaner zu werden, schließlich wusste ich aus dem Buch genug über dieses fremde Land, um lebhaft und ausführlich darüber zu erzählen. Um mein neues Leben noch echter erscheinen zu lassen, fing ich an, mir ein Alphabet auszudenken. Niemand würde meine Herkunft anzweifeln, wenn ich die japanische Sprache in Wort und Schrift beherrschte.“
Wien: Jungbrunnen 2012
„Ich entschied, Japaner zu werden, schließlich wusste ich aus dem Buch genug über dieses fremde Land, um lebhaft und ausführlich darüber zu erzählen. Um mein neues Leben noch echter erscheinen zu lassen, fing ich an, mir ein Alphabet auszudenken. Niemand würde meine Herkunft anzweifeln, wenn ich die japanische Sprache in Wort und Schrift beherrschte.“
Wenn dem Protagonisten in Rachel van Kooijs neuem Jugendroman „Menschenfresser George“ seine Lebensgeschichte nicht mehr passt, wird sie radikal geändert. Dazu braucht es im ausgehenden 17. Jahrhundert nur viel Selbstbewusstsein und Phantasie – und von beidem hat er genug, von Kindesbeinen an. Als Sohn von fahrenden Schaustellern kennt Pedrolino, wie er nach seiner Rolle gerufen wird, nur eine Welt, die betrogen sein will. Und er lernt von einer Meisterin ihres Fachs – seiner Mutter. Ohne Skrupel baut diese sich ein neues Leben auf, indem sie ihren unehelichen Sohn als den Enkel eines wohlhabenden Verwandten ausgibt. Pedrolino, der sich mittlerweile nach seinem verstorbenen Zwillingsbruder Matthieu nennt, spielt seine Rolle perfekt, hält sie bald selbst für die Wahrheit. Im Franziskaner-Konvent feiert er schulische Erfolge, weil er ein außergewöhnliches Gedächtnis hat und sehr schnell alles auswendig memorieren kann – ohne allerdings den Sinn dahinter zu begreifen. Als angeblicher Theologiestudent und Hauslehrer kann sich der heranwachsende Matthieu so eine Zeitlang ganz gut durchschwindeln, bis sich seine Ahnungslosigkeit doch nicht mehr verbergen lässt. Jahrelang zieht er, immer verwahrloster, in unterschiedlichen Identitäten in Europa umher, als verfolgter irischer Mönch, als Stiefsohn der Königin von Saba, als japanischer Prinz. Matthieus Kapital sind nicht nur sein phänomenales Gedächtnis und sein selbstbewusstes Auftreten, sondern vor allem auch seine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, sich in seine diversen Rollen mit Haut und Haar einzuleben. So lässt es sich auch erklären, dass er die britische Öffentlichkeit sogar als Ureinwohner Formosas überzeugt, des heutigen Taiwans. Inklusive Buchveröffentlichungen über seine exotische Heimat, die er nie in seinem Leben gesehen hat…. Es ist eine faszinierende historische Figur, die sich Rachel van Kooij da ausgesucht hat – denn George Psalmanazar lebte tatsächlich, so wie auch seine posthum veröffentlichten Memoiren im Internet nachzulesen sind. Aus diesem Stoff webt die österreichische Autorin, die schon mit „Ein Hundeleben für Batolomé“ (2003) und „Der Kajütenjunge des Apothekers“ (2005) ihre Begabung für den akribisch genau recherchierten historischen Roman bewiesen hat, eine Biografie der besonderen Art.
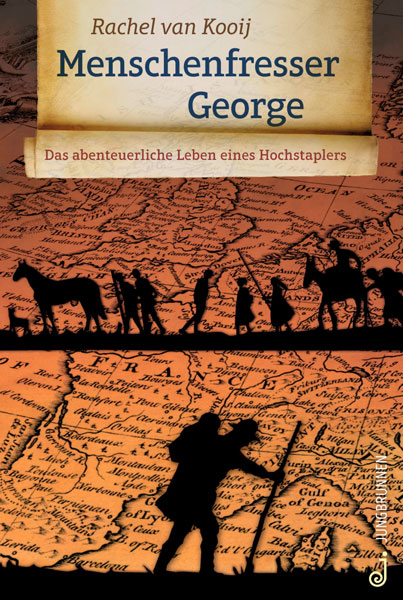
Auf der anderen Seite fühlt man sich von der Gewissenlosigkeit des egomanisch-anmaßenden Betrügers auch abgestoßen. Rachel van Kooij zeichnet diesen in vielen Facetten changierenden, schwer greifbaren Charakter mit einer Mischung aus Nähe und Distanz, indem sie ihm selbst eine Stimme gibt: Als alter Mann erzählt er, diesmal einem anonymen Leserpublikum, kurz vor seinem Tode 1752 seine Lebensgeschichte – aufgeteilt in zwanzig „Lectiones“ zwischen den Jahren 1689 und 1704. Schreibt sich alles von der Seele, um in Frieden sterben zu können, geht auf Distanz zu sich selbst. Und gleichzeitig kann er natürlich nicht aus seiner eigenen Haut, ist bis auf wenige lichte Momente unfähig, sich dem Scheitern seines Lebens wirklich zu stellen. Dass er etwa nie eine Heimat gefunden hat, keinen einzigen Freund, keine Liebe – darüber will auch der alte Mann nicht nachdenken. Dass er zwar viele Rollen spielte, aber nie das Stück bestimmte, in dem er auftrat, dass er über den vielen Masken, die er trug, sogar seinen wahren Geburtsnamen vergessen hat – auch das wird nicht in der Ich-Erzählung reflektiert, sondern nur zwischen den Zeilen spürbar. Eine spannende, abenteuerliche Geschichte, in der man noch dazu einiges über die Strukturen und Lebenswelten in Europa am Ende des 17. Jahrhunderts erfährt - und die einen auch irgendwie nachdenklich macht. Wie sagte Schnitzler sinngemäß: „Wir spielen alle, wer es weiß, ist klug.“