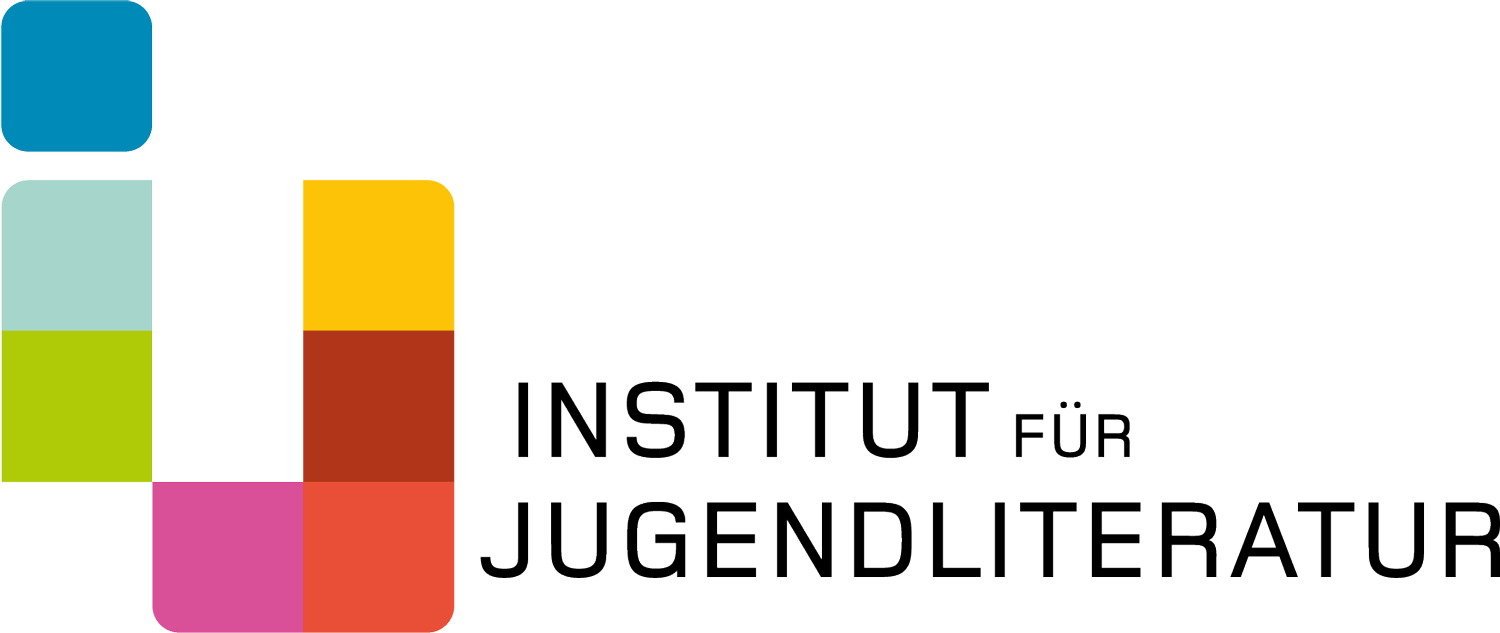Christian Frascella: Meine Schwester ist eine Mönchsrobbe
„Die Männer fürchteten mich. Denn die Frauen waren scharf auf mich. Warum würden sie sich sonst so viel Mühe geben, mich lächerlich zu machen?“
Frankfurt: Frankfurter Verlagsanstalt 2012
„Die Männer fürchteten mich. Denn die Frauen waren scharf auf mich. Warum würden sie sich sonst so viel Mühe geben, mich lächerlich zu machen?“ Mit großer Kreativität versucht der namenlos bleibende 17jährige Ich-Erzähler in Christian Frascellas Debutroman „Meine Schwester ist eine Mönchsrobbe“ sich seine Realität umzudeuten. Und die kann ein wenig Verschönerung durchaus vertragen: Seine Mutter ist mit einem Tankwart durchgebrannt, sein Vater ein trinkfester Gelegenheitsarbeiter, dessen Erziehungsmaßnahmen darin bestehen, den Sohn zu verprügeln, seine verklemmte Schwester rennt dauernd in die Kirche. Und er selbst ist natürlich nicht der gefürchtete Held und begehrte Liebhaber, sondern ein von allen verlachter Versager, der die Schule geschmissen hat, in Kämpfen immer unterliegt und sogar von der Ohrfeige eines Mädchens ausgeknockt wird. Freunde hat er keine, Erfolge bei Frauen schon gar nicht, denn niemand will etwas mit ihm zu tun haben.
Daran ist er allerdings selbst schuld. Dieser Junge ist der Prototyp eines provokant-arroganten Großmauls, der dauernd blöde Sprüche klopft und aggressiv auf Streit aus ist. Warum man ihn als Leser trotzdem mag? Weil überdeutlich wird, dass hinter dem unerträglich angeberischen Gehabe Sensibilität, Verletzlichkeit und pure Verzweiflung stecken. Weil seine Strategie, jede Blamage – und davon gibt es viele – als Sieg umzudeuten, so dermaßen realitätsfern ist, dass sie amüsiert. Und eines muss man ihm lassen: Feige ist er nicht, und auf den Mund gefallen schon gar nicht. Sein schlagfertiger, wortgewandter Sarkasmus verblüfft seine Umgebung genauso wie die stoische Unverfrorenheit, mit der er sich in Situationen hineinmanövriert, in denen er nur untergehen kann. Er ist ein Verlierer, aber einer, der kämpft bis aufs Blut, und das im wörtlichen Sinne. Wie er versucht, sich durchzuschlagen, ist nie political correct. Chiara, das Objekt seiner Begierde, stößt er immer wieder mit peinlichem Macho-Auftreten vor den Kopf, in der Metallfabrik, in der er als Lehrling unterzukommen versucht, gibt er sich als Neofaschist aus, um seinem Vorgesetzten nach dem Mund zu reden. Denn dort, zwischen den Autoersatzteilen, mutiert seine Alltags-Renitenz zu konsequenter Rückgratlosigkeit. Bis er, ganz am Ende, doch noch die Kurve kriegt.
Es ist bemerkenswert, wie es der Turiner Autor schafft, im Grunde unsympathische Figuren sympathisch werden zu lassen.
Sogar der Vater, vom Sohn nur „Chef“ genannt, ein in der Hängematte Bier trinkender Working Class Hero, tritt nicht als bösartiger Kindes-Misshandler auf, sondern als eher einfach gestrickter Mann, der von der Situation des Alleinerziehers hoffnungslos überfordert ist.

Jahrelang hat sich unser Anti-Held nicht für seine Familie interessiert, genauso wenig wie sie mit ihm klar gekommen ist. Es wird nicht wirklich miteinander geredet, Zuwendung ist ein Fremdwort. Da muss schon der Vater mit lebensbedrohlicher Leberblutung im Krankenhaus liegen, dass der Bruder die Schwester umarmt, seit Ewigkeiten wieder.
„Meine Schwester ist eine Mönchsrobbe“, das in Italien zum Bestseller wurde, trägt nicht umsonst einen un-eindeutigen Titel, der neugierig macht. Eine Neugierde, der man nachgeben sollte. Dann wird man mit der Lektüre eines sehr pointierten, tragikomischen Buches belohnt. Auch wenn man es nicht so sehr mit Machos hat. Oder vielmehr gerade dann.