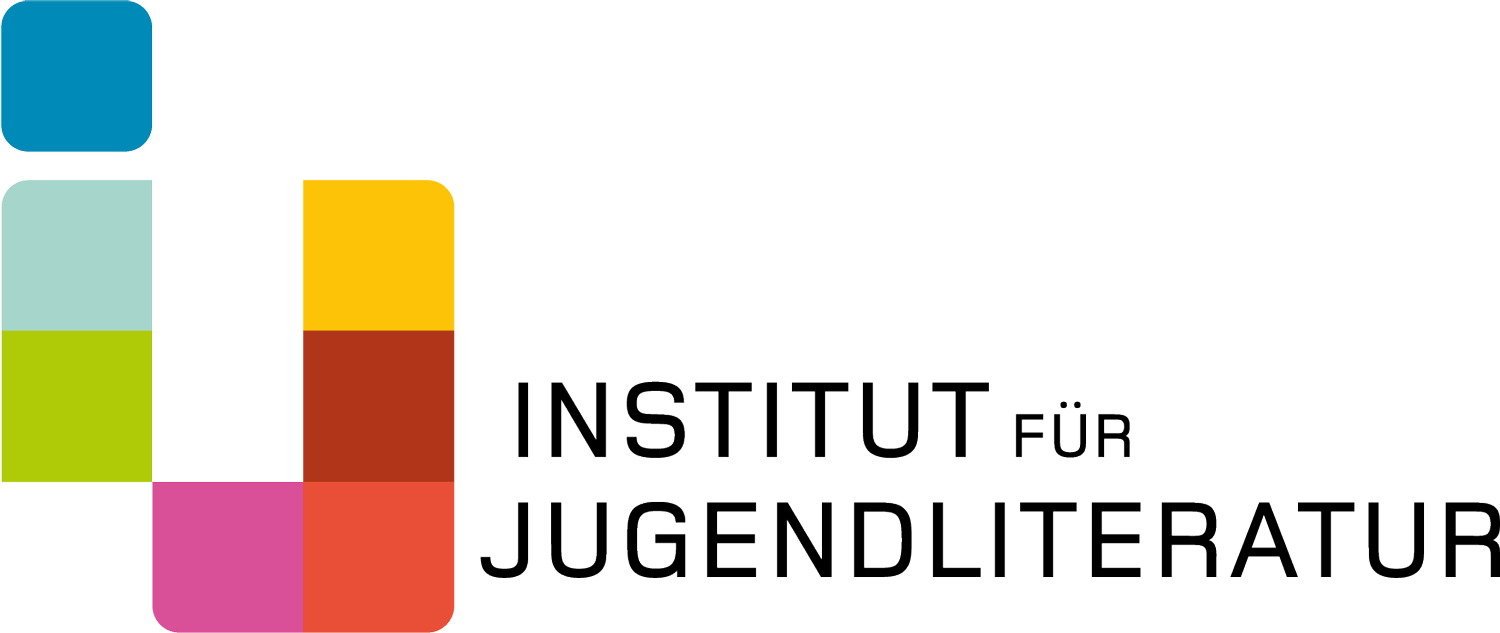Andreas Thalmayr: Lyrik nervt
„Es gibt überhaupt kein Gehirn in der Welt, in dem es nicht von Gedichten wimmelt. Das kann ich beweisen!“ sagt Andreas Thalmayr in seinem Band „Lyrik nervt“ – und tut es.
München: Hanser 2004
„Es gibt überhaupt kein Gehirn in der Welt, in dem es nicht von Gedichten wimmelt. Das kann ich beweisen!“ sagt Andreas Thalmayr in seinem Band „Lyrik nervt“ – und tut es. Nicht, indem er einfach eine Anthologie zusammenstellt, sondern indem er davon erzählt, was ein Gedicht überhaupt ist, wie es entsteht, welche Tricks und Regeln es dabei gibt.
Belegt werden seine Ausführungen durch eine Vielzahl von Beispielen, in roter Farbe hervorgehoben, und am Cover prangt das Rot-Kreuz Zeichen. Schließlich lautet der Untertitel: Erste Hilfe für gestresste Leser.
Nach dem „Wasserzeichen der Poesie“, mit dem er erwachsene Leserinnen und Leser für Lyrik zu begeistern versuchte, wendet er sich zwanzig Jahre später an ein jugendliches Publikum. In seinem aus einem enormen Wissensfundus schöpfenden Spaziergang durch die Jahrhunderte und Kontinente kommt nahezu alles vor, was zum Thema „Lyrik“ zu sagen ist. Ohne auch nur ansatzweise langweilig zu werden. Es ist tatsächlich eine eigene Kunst, Themen wie Versmaße – im Kapitel „Tanzstunde“ – Sonnette oder Balladen so zu bringen und gleichzeitig auch astreine literaturwissenschaftliche Definitionen zu liefern, ohne dass man sich an eine Unterrichtsstunde im Gymnasium erinnert fühlt.
Thalmayr schafft es. Mit lockerer Ungezwungenheit im Zugang, Respektlosigkeit auch gegenüber den „Großen“ wie Heine („zugegeben, kein so dolles Gedicht“) und mit einem sehr leicht lesbaren flapsigen Ton. Und auf den Ton kommt´s, wie er nachdrücklich erläutert, ja an. Wenn die Dadaisten das Sonett schon lange vor Robert Gernhardt beschissen finden oder ein Gottfried Benn als „kraß“ bezeichnet wird, hält sich das nicht unbedingt an die allgemeinen germanistischen Sprachgepflogenheiten.
Der Autor pfeift streckenweise auf wissenschaftliche Objektivität und gibt ohne viel Federlesens seine subjektiven Kommentare zu den Gedichten oder Schriftstellern ab: Da ist Peter Rühmkorff „der größte lebende Vers-Virtuose Deutschlands“, Rilke ist „ausgefuchst“, und wer die Odyssee geschrieben hat, weiß man nicht so genau; man hat sich darauf geeinigt ihn Homer zu nennen“.
Wer was wann geschrieben hat, ist zunächst einmal uninteressant, es geht alleine um das jeweilige Gedicht. Nicht immer wird im Text verraten, wer für die zitierte Lyrik verantwortlich ist. Wer sich für den Autor interessiert, muss sich häufig zum Anhang bemühen.
Und der weist eine Art „Best of Lyrik“ aus, kombiniert mit einigen „Worst of“ dort, wo Thalmayr es brauchen konnte. Die Beatles kommen genauso vor wie Jandl, Schiller, Goethe (natürlich), Eichendorff, Brentano, Fontane, Morgenstern, Robert Gernhardt ... die Liste ist noch lange nicht zu Ende. Wann sie gelebt haben, wann sie das zitierte Gedicht geschrieben haben – who cares?
Im Anhang ist nämlich nur das Erscheinungsjahr der jeweiligen Quelle, nicht das Entstehungsdatum, zu finden, was dem aufmerksamen Leser spätestens bei der Publikationsangabe der Merseburger Zaubersprüche – 1970 – auffällt. Aber dafür erfährt man, dass der „Taucher“ genauso gut ist wie „Midnight Rambler“ von den Stones. Schließlich ist „Lyrik nervt“ keine Literaturgeschichte und kein Schulbuch, auch wenn es sich natürlich hervorragend für den Unterricht eignet. Denn im Unterschied zum „Wasserzeichen der Poesie“ ist die Hintergrundfolie, vor der sich alles abspielt, diesmal ein wohldurchdachtes pädagogisches Konzept.

Unter den zitierten Dichtern findet sich übrigens ein gewisser Hans Magnus Enzensberger. Dass er höchstpersönlich hinter dem Thalmayr-Pseudonym steht, ist ein mittlerweile offenes Geheimnis. Dem jungen Leser wird´s egal sein – aber für diese etwas andere Art des Literaturunterrichts ist er vermutlich dankbar. Vielleicht lässt er sich auch von der abschließenden Anleitung zum Selbermachen von Gedichten hinreißen, reimt „Papa“ auf „Grappa“ und folgt Enzensbergers Credo: Lyrik ist cool!