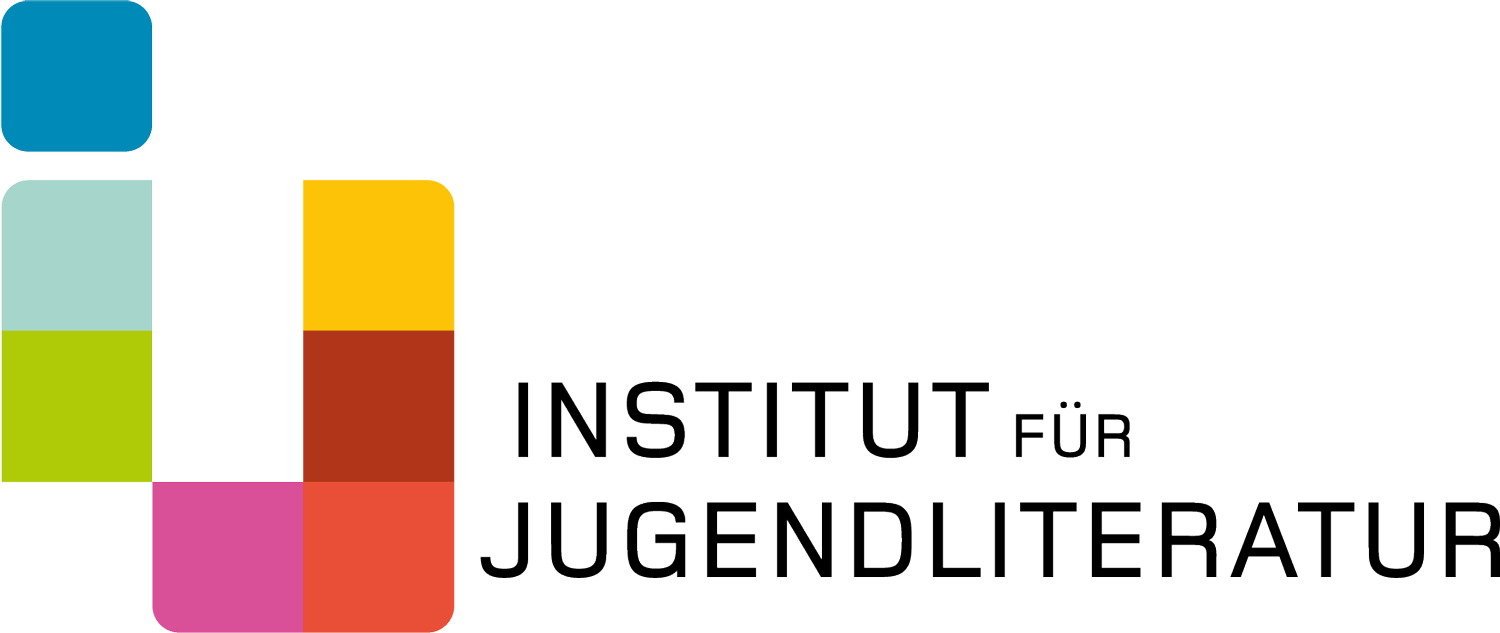Nadia Mikail: Katzen, die wir auf unserem Weg trafen
Die streunende Katze, der Aisha und ihr Freund Walter auf dem Heimweg begegneten, hatte, heißt es gleich zu Beginn, "einen kahlen Fleck am linken Hinterlauf, und ein Ohr fehlte. Sie war orangefarben, so eine unangenehme, schmuddelige Art von Orange, die Aisha an ein verdorbenes Curry-Gericht erinnerte." Das Tier ließ sich nicht davon abbringen, die beiden Jugendlichen nach Hause zu begleiten. Auf Aishas Einspruch, die Katze habe sicher Flöhe, antwortete Walter nur: ""Ich glaube, das macht nichts", und meinte damit jetzt wo wir sowieso alle sterben.“
Denn das steht in diesem Roman von Anfang an fest, auch wenn man es nicht so recht glauben mag angesichts des strahlend grünen Campingbusses mit blaugepunkteten Vorhängen in den Fenstern, der vor leuchtendem Abendrot fröhlich über das Cover rollt. Auf dem neben dem Titel „Katzen, die wir auf unserem Weg trafen“ aber eben auch die Frage abgedruckt ist: "Mit wem möchtest du das Ende der Welt erleben?"
Dass es bevorsteht, davon hatten Aisha und Walter vier Monate vor der Begegnung mit der Katze erfahren. Mit einem Wochenende am Strand wollten die beiden ihren Schulabschluss feiern, ihre Zukunft, die wie der Strand "in goldenes Licht gehüllt“ schien. Bis von einem auf den anderen Moment zuerst die Handys und dann die Menschen rund um sie herum verrückt spielten, alle wie panisch ihre Sachen zusammenpackten und den Strand verließen. Es war der Moment, in dem – von den Regierungen weltweit akkordiert – bekannt gegeben wurde, dass ein riesiger Asteroid unterwegs Richtung Erde sei, in 12 Monaten auf sie treffen und sie zerstören werde. Unwiderruflich. Wer sich nun die Darstellung einer entfesselten Endzeit erwartet, ein Plündern und Morden oder vielleicht den glanzvollen Auftritt von Held:innen, die mit Willen und Kraft Erde samt Menschen retten, wird enttäuscht. Nadia Mikail inszeniert die Prä-Apokalypse fast geräuschlos. Nach einer kurzen Zeit des Chaos und der Anarchie, in der nach und nach alles geendet hatte, wie fast nebenbei erwähnt wird, ist es mittlerweile still geworden.
„Viele taten weiter, was sie konnten, solange sie noch da waren, solange das Leben noch währte, versuchten, die letzten Wochen und Monate ruhig und sicher mit ihren Liebsten zu verbringen.“ Die junge malaysische Autorin, die gegenwärtig in England lebt, konzentriert sich in ihrer Schilderung der vorletzten Tage der Menschheit ganz auf ihre beiden Protagonisten Aischa und Walter und deren Eltern. Schickt die Handvoll Menschen zusammen auf eine Reise über die malaysische Halbinsel, um Aischas Schwester zu suchen, die drei Jahre zuvor verschwunden war.

Was bleibt, wenn nichts mehr kommt? Wie die Gegenwart gestalten ohne Zukunft? Wohin mit Wut und Trauer und noch mehr Wut, wenn es keine Hoffnung gibt? Und: Was zählt die Erinnerung an die eigene Geschichte, wenn man in niemandes Erinnerung weiterleben wird?
In einem Roman, der sich weniger vorwärts bewegt, als dass er – auch in den eingestreuten Rückblicken – nach hinten mäandert, stellt Nadia Mikail diese Fragen, ohne pathetisch zu werden. Sie erzählt unspektakulär, leise, fast elegisch von einer Handvoll Menschen, die angesichts des Weltenendes für einander da sind, sehr nahe zusammenrücken.
Was auf dieser emotionalen Lesereise für eine wohltutende Distanz sorgt, ist eine Art kulturelle Kluft, die immer spürbar ist. Auch wenn Nadia Mikail religiöse und ethnische Differenzen zwischen ihren Figuren nur andeutet, bleiben einem die Art der familiären Beziehungen, die Landschaft und Alltagskultur, die sie wie selbstverständlich einbindet, immer ein wenig fremd. In der feinen Übersetzung Uwe-Michael Gutzschhahns aus dem Englischen wird das noch unterstrichen, indem hier und da Begriffe oder Sätze in malaysischer Sprache stehen geblieben sind.
Die Katze mit dem räudigen Fell in der Farbe eines verdorbenen Curry-Gerichts wurde im Übrigen Flohsack getauft und hat ihre Wahlmenschen auf die Reise begleitet. Wie sich herausstellte, hatte sie keine Flöhe.