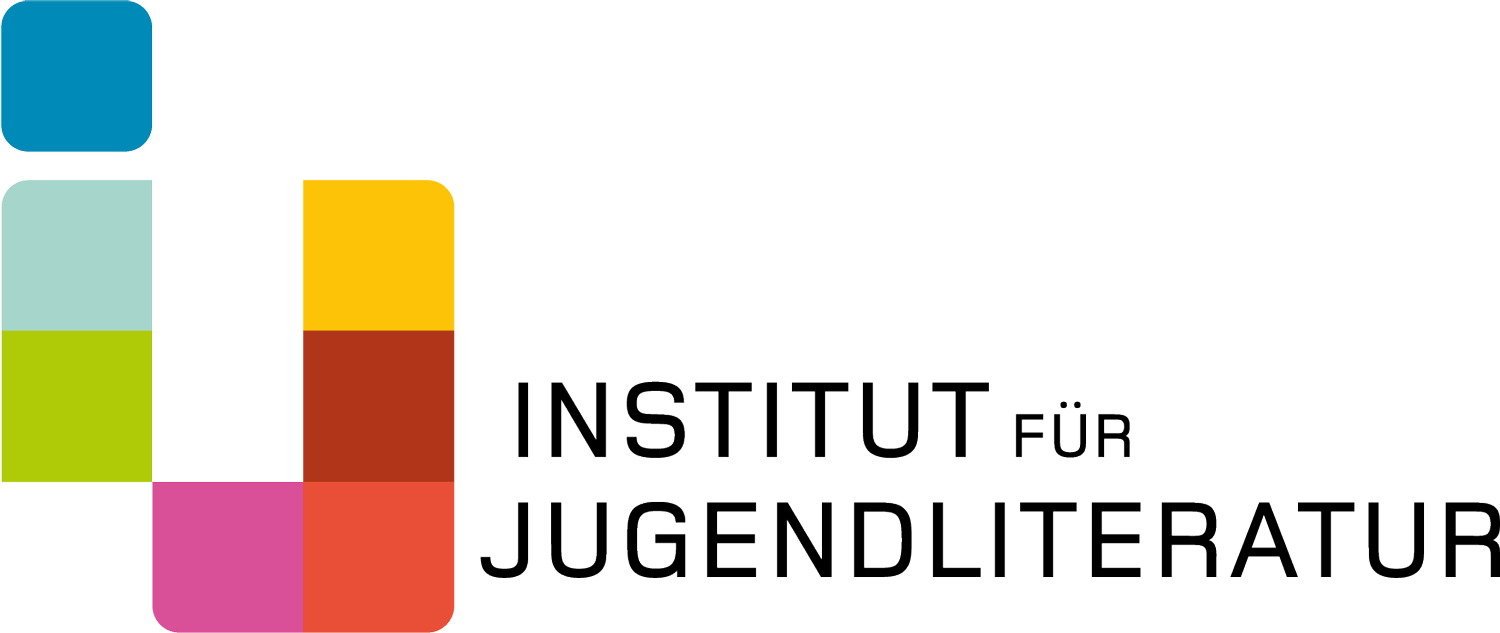Nils Mohl: Es war einmal Indianerland
„Es war einmal Indianerland“: Für den Hamburger Autor Nils Mohl hat die Großstadt einiges mit dem Wilden Westen zu tun. Gekämpft wird zwar nicht mit Revolvern, sondern mit Fäusten, doch für zartbesaitete Gemüter ist sie jedenfalls nichts.
„Es war einmal Indianerland“: Für den Hamburger Autor Nils Mohl hat die Großstadt einiges mit dem Wilden Westen zu tun. Gekämpft wird zwar nicht mit Revolvern, sondern mit Fäusten, doch für zartbesaitete Gemüter ist sie jedenfalls nichts.
Der siebzehnjährige Ich-Erzähler lebt in einer Plattenbausiedlung am Stadtrand, im Ghetto. Es sind Sommerferien, er verbringt seine Zeit mit einem Job am Bau, Boxtraining oder einem nächtlichen Ausflug in ein Freibad. Wo er Jackie kennenlernt, die rothaarige Diva aus dem Viertel der Reichen, in die er sich aus dem Stand rettungslos verknallt.
Und so beginnt der Roman damit, dass der Junge am Fluss sitzt, umsonst auf Jackie wartend, in einen Dialog mit Mauser vertieft. Den man zunächst für einen Freund des Protagonisten hält, bis sich die Hinweise darauf mehren, dass man es hier mit einer Variation von „Fight Club“ zu tun hat, dem fulminanten, v.a. durch seine Verfilmung bekannten Roman von Chuck Palahniuk. Und irgendwann stellt die namenlos bleibende Hauptfigur unmissverständlich fest: „Mauser ist ein Teil von mir, der Boxer, an dem sein Vater besonders hängt. Ich bin deshalb nicht schizo. Nur erwachsener, wenn es darauf ankommt.“
Das ist nicht die einzige erzählerische Volte, die der Autor schlägt. Wer lineares Erzählen liebt, hat es mit dem „Indianerland“ schwer. Dreizehn Tage umfasst der Text, eine Zeitspanne, in der er permanent vor und zurück springt, mit „forward“ und „rewind“ und Pausetasten als Unterbrechungen, in denen „Dinge, die ich sicher weiß“ oder eben „nicht sicher weiß“ festgehalten werden.
So fügt sich nach und nach der Plot zusammen. Im ersten Teil erzählt er die Geschichte von Mauser und Jackie, von seinem Umfeld, in dem Kinder an Drogen sterben, Boxkämpfe statt Gesprächen geführt werden. Von seiner völlig aussichtlosen Verliebtheit in ein Mädchen, das ihn in gelangweilter Oberflächlichkeit an der Nase herumführt. Von seinem Vater, der seine Stiefmutter erwürgt hat und nun auf der Flucht ist. Ist der erste Teil mit dem Schlagwort „Krieger“ übertitelt, gibt der zweite Teil „Grenzen“ als Motto vor. Und so verlässt der Junge auch die Großstadt, fährt auf der Suche nach Jackie und/oder, das weiß er selbst nicht so genau, seinem flüchtigen Vater zu einem Festival, das nicht nur geographisch an der Grenze liegt, sondern ihn auch an seine eigenen Grenzen heranführt.
Begleitet von Edda, die ihn zunächst unerwidert liebt, wird er zusammengeschlagen, trifft Jackie, seinen Vater – und findet dabei einiges über sich selbst heraus. Wird sich seiner Naivität insbesondere in Sachen Liebe bewusst, weshalb der zweite Teil nicht mehr die Geschichte eines Kriegers ist, sondern die „von Grünhorn und Edda“. Der Ich-Erzähler ist eben einer, der noch viel über das Leben lernen muss.

Anders als mit extremer Genauigkeit und Durchdachtheit wäre dieser Erzählstil auch nicht durchzuhalten, doch so ergibt sich in spannender Dramaturgie das komplexe Psychogramm eines jungen Mannes, der den Part des lonesome cowboys übernommen hat. Der sich selbst mit „Neigung zur Selbstisolation, kein Freundeskreis. Ist gewöhnlich so gern unter Menschen wie ein Biber in der Tellereisen-Falle eines Trappers.“ charakterisiert.
Am Schluss stehen ein wenig mehr Selbsterkenntnis und – schließlich legt schon der Titel eine gewisse Märchenhaftigkeit nahe - das Happy End mit Edda. Genau dieses vorhersehbare Ende und insbesondere die letzten zwei Seiten hätte sich der Autor sparen können; das ist aber das einzige, was man diesem rasanten Roman vorwerfen kann, denn glücklicherweise überwiegen die anderen 340 Seiten, in denen sich ein Jugendlicher beeindruckend durch seinen ganz persönlichen inneren und äußeren Wilden Westen kämpft. Und weil zu einem guten Western auch Musik gehört, gibt es ganz am Schluss auch den eher härteren Soundtrack zum Buch aufgelistet, von den Smashing Pumpkins bis zu Nirvana. Es ist eben so, wie es auf dem T-Shirt einer der Figuren zu lesen ist: „Das Leben ist kein Ponyhof.“