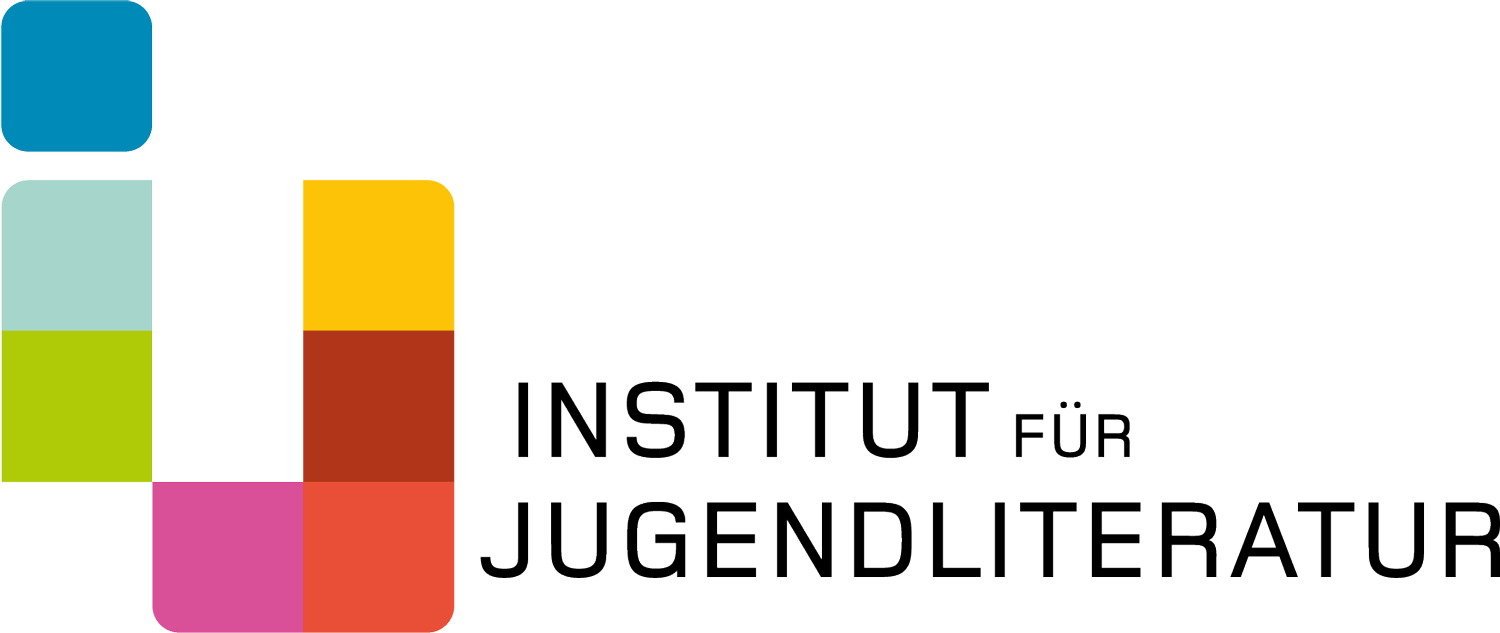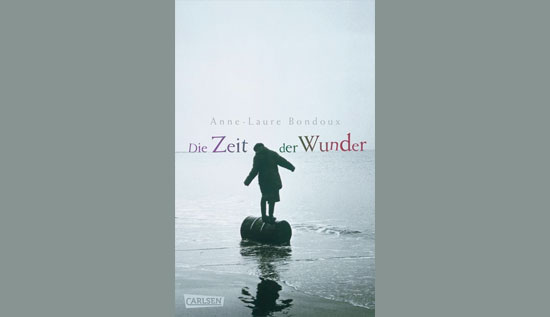
Anne-Laure Bondoux: Die Zeit der Wunder
„Als Gloria von der Arbeit kommt, frage ich sie, ob man während des Krieges glücklich sein darf. Sie schaut mich ernst an und wischt sich den Schmutz von den Wangen, bevor sie antwortet: Glücklich sein wird zu jeder Zeit empfohlen, Monsieur Blaise.“
Hamburg: Carlsen 2012
„Als Gloria von der Arbeit kommt, frage ich sie, ob man während des Krieges glücklich sein darf. Sie schaut mich ernst an und wischt sich den Schmutz von den Wangen, bevor sie antwortet: Glücklich sein wird zu jeder Zeit empfohlen, Monsieur Blaise.“
Und so ist es möglich, dass das Flüchtlingsleben des Jungen Koumail in Anne-Laure Bondoux´ neuem Roman nicht nur eine Odyssee durch Hunger, Kälte, Angst und Verzweiflung ist, sondern eben auch „Die Zeit der Wunder“.
Quer durch den vom Bürgerkrieg zerrissenen Kaukasus führt Koumails Weg, zusammen mit seiner Ziehmutter Gloria, die ihn – wie sie ihm immer wieder erzählt - als Baby aus einem zerbombten Zug gerettet hat. Wie unzählige andere Flüchtlinge versuchen sie zu überleben, der Miliz zu entkommen, Essen zu finden. Zunächst in Tiflis, dann in Souma-Soula, einem aus Brettern, Blech und Plastik zusammengeflickten Dorf in den Bergen, wo sie auf einer Mülldeponie Nickelfäden sammeln. Als Ziel immer Frankreich vor Augen – denn schließlich ist Koumail nicht Koumail, sondern Blaise Fortune, nicht Georgier, sondern Franzose. So will es zumindest Glorias Erzählung. Und der Junge kommt tatsächlich bis an die Grenze:
„An dem Tag, als die Zollbeamten mich hinten im Lastwagen fanden, war ich zwölf Jahre alt. Ich roch so schlecht wie Abdelmaliks Müllhäuschen, und ich konnte nur immer wieder diesen einen Satz sagen: „Ichheißebläsfortünuntichbinbürgaderfranzösischenrepublikdasisdiereinewaheit“.
Gloria ist nicht mehr bei ihm. Koumail kommt in ein Durchgangslager, in ein Erstaufnahmezentrum, in ein Heim des Kinderhilfswerks. Wird wirklich zu Blaise Fortune, mit französischem Leben und französischem Pass. Er hat Glück gehabt. Es dauert acht Jahre, bis er nach Tiflis reisen und Gloria wiederfinden kann. Und endlich die Wahrheit über sein Leben und seine Herkunft erfährt.
„Die Zeit der Wunder“ erzählt von Menschen, die sich den Kriegswirren mit Mut und Widerstandsfähigkeit, Menschlichkeit und Phantasie entgegen stellen. Von Politik ist dabei genauso wenig explizit die Rede wie von der geradezu unbeschreiblichen Kraft, mit der Gloria sich und Koumail durchbringt, ihm auch in Blechhütten und staubigen Speichern so etwas wie Alltag vermittelt, in ihm den Glauben an ein besseres Leben aufrechterhält. Hoffnung als einzige Waffe gegen die Verzweiflung.

Sein Glück inmitten des Elends ist nicht relativ – sondern absolut. Auch wenn er immer wieder Abschied nehmen muss, auch wenn er, natürlich, nichts idealisieren kann: „Im Leben läuft nichts so, wie man es gerne möchte, das ist die reine Wahrheit. Man möchte jemanden für immer lieben, doch man muss sich trennen. Man möchte Frieden, doch es gibt Unruhen. Man möchte ein Schiff nehmen, doch man muss in einen Laster steigen.“
Auch wenn sie es nie wörtlich ausspricht: Jeder, so das Credo der französischen Autorin, hat das Recht, sein Leben in Freiheit zu leben. Ohne von Grenzen daran gehindert zu werden. Bondoux stellt den äußeren Bedingungen – Bomben, verkrüppelten Soldaten, Essen aus Mülleimern, Betteln, Baden in einem von Abwässern vergifteten See - das innere Erleben eines kleinen Jungen gegenüber, der sich – trotz allem – seine Träume und Hoffnungen bewahrt und das Schöne im Furchtbaren wahrnehmen und annehmen kann. Dadurch gewinnen beide Seiten an Schärfe und Intensität. So wird das Schreckliche zwar nicht weniger schrecklich, aber zumindest bewältigbar:
„Manchmal muss man sich Geschichten ausdenken, damit das Leben erträglich bleibt.“ Nicht nur Sätze wie diese machen das Buch zu einem, das man nicht so schnell vergisst.