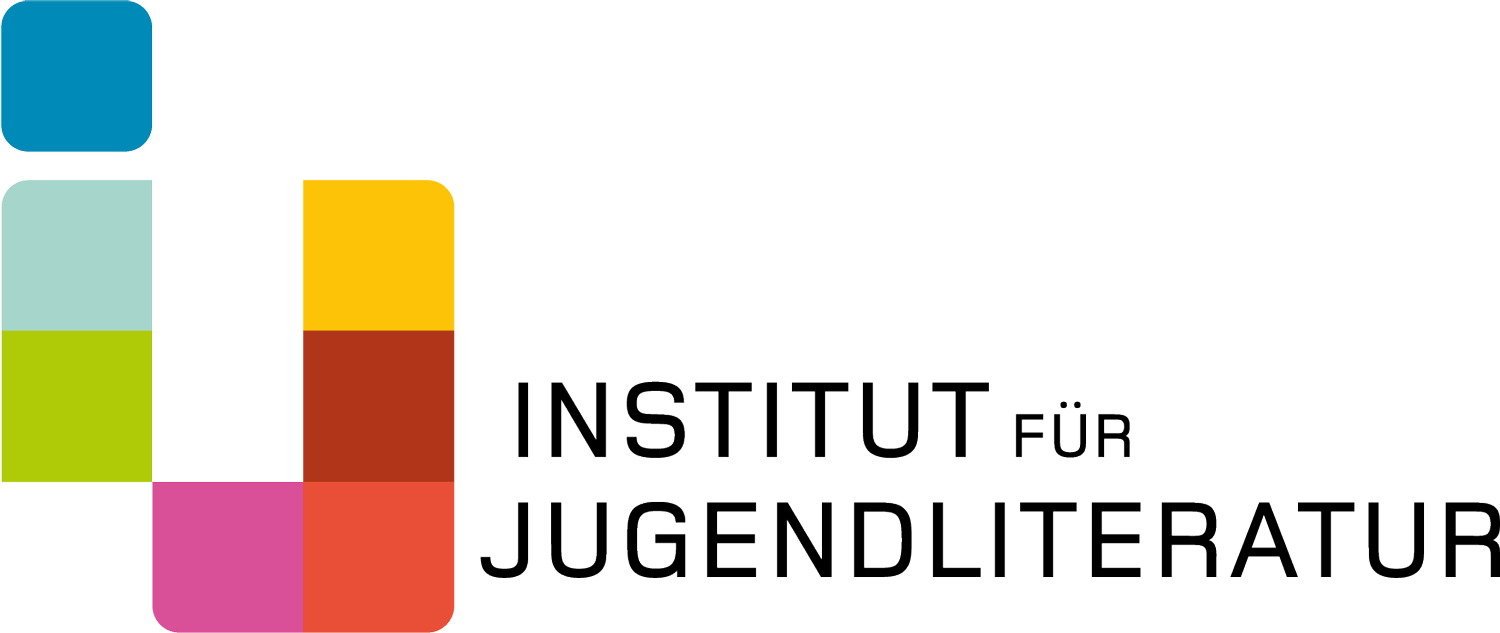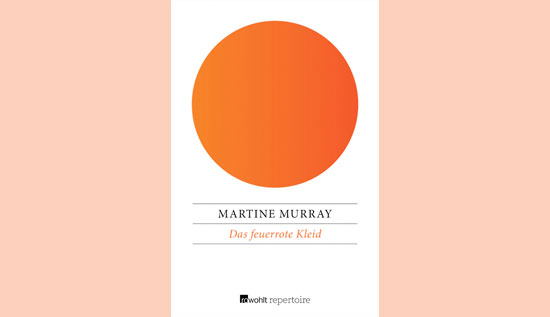
Martine Murray: Das feuerrote Kleid
Martine Murray seziert das Innenleben einer bis ins Mark verunsicherten 16-Jährigen, die nie gelernt hat, eine tragfähige positive Beziehung zu sich selbst oder ihrer Umwelt aufzubauen.
Rot ist mehr als nur eine Farbe. Rot bedeutet Leidenschaft, Dramatik, Außergewöhnlichkeit. Eigenschaften, die die Ich-Erzählerin Manon in Martine Murrays neuem Jugendroman „Das feuerrote Kleid“ in ihren eigenen Augen nicht besitzt. Sie muss sie sich anziehen, überstülpen, indem sie das Kleid ihrer Mutter trägt. Einen Tag und eine Nacht lang. 24 Stunden, in denen sie von zu Hause fortgeht in der Hoffnung auf einen neuen Anfang, ein neues Leben, ein neues Ich. Denn das alte bedeutet nur Schmerz und Verlust.
Martine Murray seziert das Innenleben einer bis ins Mark verunsicherten 16-Jährigen, die nie gelernt hat, eine tragfähige positive Beziehung zu sich selbst oder ihrer Umwelt aufzubauen. Die manisch-depressive Mutter, angeblich eine französische Schauspielerin, kann ihren Lebenshunger in der australischen Kleinstadt nicht stillen und verlässt die Familie mit einem anderen Mann. Wirklich anwesend war sie ohnehin nie. Die gleichgültige Ich-Bezogenheit, mit der sie ihre Tochter nicht wahrnimmt, führt das Mädchen in ein umfassendes Gefühl der Minderwertigkeit, das sich bis zur Selbstentfremdung steigert. „Wenn man sich also nach etwas sehnt und wartet und wartet und sich sehnt, dann ist man ständig hin und her gerissen. Man geht in einer Zickzacklinie anstatt geradeaus wie die meisten anderen Leute. Es ist, als blieben die Knochen an Ort und Stelle, während Herz und Seele so weit vorausgeeilt sind, dass man sie nicht mehr zurückholen kann. Man ist also möglicherweise nicht mal mehr ganz, und am Ende fühlt man sich verzweifelt und finster, wie diese Pappeln, die sich wie ein Bogen über die Einfahrt der Nelsons beugen.“
Als ihr Bruder Eddie tödlich verunglückt, verschwindet die einzige Bezugsperson in Manons Leben. Denn die beginnende Liebe zu ihrem Nachbarn Harry ist noch zu vage und neu, als dass sie ihr in ihrem emotionalen Chaos Halt oder Orientierung geben könnte.
Das klingt alles düster, schwierig, schwer. Ist es auch. Doch das Buch lässt einen irgendwie nicht mehr los - nicht nur, weil das Psychogramm so intensiv ist: Durch die verschachtelte Erzählweise bekommt die Geschichte einen Zug, der einen zum Weiterlesen zwingt.
Erst Stück für Stück entrollt sich die Geschichte: Die Abwesenheit der Mutter ist zwar von Anfang an zwischen den Zeilen zu lesen – die Hintergründe werden aber erst nach und nach klar. Von Eddies Tod, dem handlungsauslösenden Moment, erfährt man überhaupt erst im letzten Buchdrittel.
Chronologisch nicht geordnete Rückblenden durchbrechen laufend die erzählte Gegenwart von Manons Fahrt nach Melbourne: Eine Reise zu ihrer im Altersheim lebenden Großmutter und zu einer von Eddie hinterlassenen Adresse, von der sie vorerst noch nicht weiß, wer sie dort erwartet. Und genau diesen Lücken will man als Leser auf die Spur kommen.

Herausgekommen ist das dicht erzählte Protokoll einer Selbstfindung, deren Ausgang hier nicht verraten werden soll. Nur soviel: am Ende liegt das feuerrote Kleid an einem Strand. Man kann den Versuch, sich ein neues Ich anzuziehen, auch abbrechen.