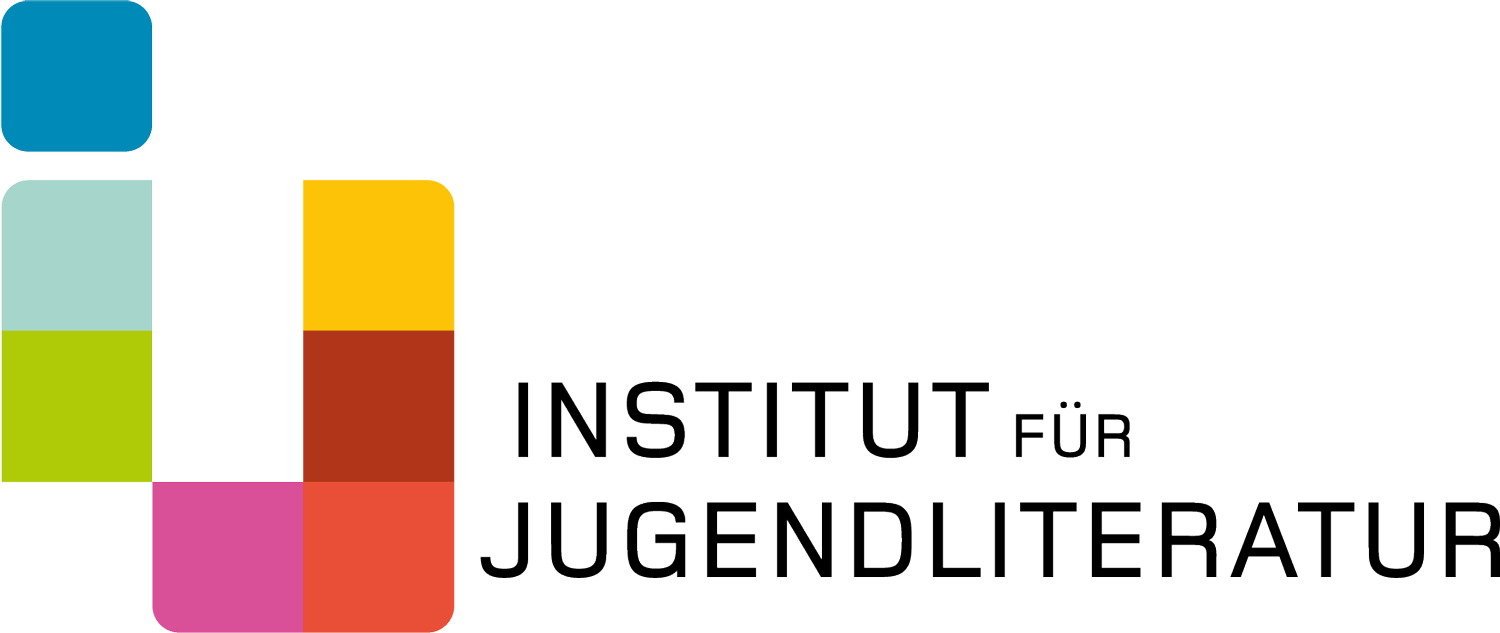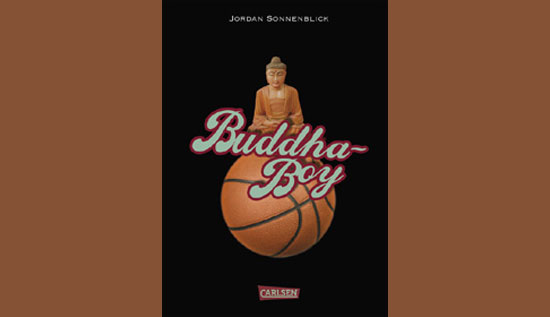
Jordan Sonnenblick: Buddha-Boy
Eine eigene Identität zu fühlen, ist nicht selbstverständlich. Jugendliche kämpfen mitunter hart darum.
Hamburg: Carlsen 2012
Eine eigene Identität zu fühlen, ist nicht selbstverständlich. Jugendliche kämpfen mitunter hart darum. So auch der vierzehnjährige Ich-Erzähler San Lee in Jordan Sonnenblicks „Buddha-Boy“. Dabei hat ihm das Leben Steine in den Weg gelegt: Seine Familie zieht permanent um, er hat nach fünf US-Bundesstaaten und einem Flugstützpunkt in der BRD dementsprechend viele Schulwechsel hinter sich. Und vor allem – er hält sich an das Motto seines Vaters: „Du musst mit den Wölfen heulen“. San war ein Skater in Kalifornien, ein Bibelfreak in Alabama, ein durchgestylter Typ in Houston und ein Möchtegern-Macho in Deutschland. „Kindern wird immer empfohlen, einfach nur sie selbst zu sein. Aber entweder ist es nicht ehrlich gemeint oder es wird einem nicht gesagt, wie das zu schaffen ist, wenn alle einen so lange schubsen und an einem herumzerren, bis man sich wie alle anderen benimmt.“
So stellt sich ihm an seiner neuen Schule in Pennsylvania die Frage, wer er diesmal sein will. Er beschließt, etwas ganz Neues zu versuchen: „Ich könnte vorgeben, einmalig zu sein.“ Auf der Suche nach etwas, was ihn aus der Masse herausragen lässt – „das war schwieriger als herauszufinden, wie man der Masse folgt“ – stolpert er eher zufällig in den Buddhismus. Was insofern naheliegt, als er chinesischer Abstammung ist – er wurde adoptiert. So setzt er sich in Zazen-Haltung auf einen Felsen vor dem Schuleingang, gibt vor, dass er von Kindesbeinen an in der Tradition des Zen-Buddhismus lebt, verkündet in Sandalen fernöstliche Weisheiten. Dabei hat er sein ganzes neu erworbenes Halbwissen aus der Bücherei. Vor allem anderen will er damit Woody beeindrucken, in die er sich auf den ersten Blick rettungslos verliebt hat. Sie ist definitiv keine, die mit den Wölfen heult, sein „Beatles-Mädchen“ singt in der Cafeteria mit der Gitarre alte Folksongs von Woody Guthrie. Eigentlich heißt sie ja Emily, aber wie San wollte sie eine andere werden: „Woody war wie ich. Wegen unserer verkorksten Eltern erfanden wir uns neu.“
So wie Emilys Mutter die Familie verlassen hat, ist auch San´s Vater nicht mehr da – er sitzt wegen Betruges im Gefängnis. Emily will ihre Mutter zurück. San wünscht sich, dass sein Vater für immer weggeschlossen bleibt und verweigert seit einem Jahr jeden Kontakt zu ihm. Von alledem kann er natürlich nichts erzählen, wenn er seinen Buddha-Schein aufrechterhalten will. Wie zu erwarten fliegt ihm am Ende seine Lügengeschichte um die Ohren und die Wahrheit auf.
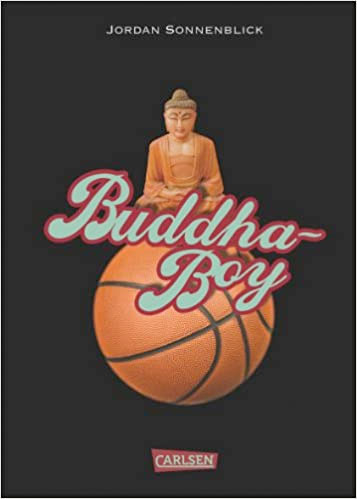
Denn Sonnenblick´s Zugang definiert sich über den Humor: Vor allem in den Kommentaren zu seinem eigenen Verhalten treibt der Ich-Erzähler die Selbstironie auf die Spitze. Und es gibt viel Situationskomik, etwa wenn San einen Hamburger essen will ohne daran zu denken, dass er als Buddhist eigentlich Vegetarier sein sollte, oder seine unfreiwillige Rettungsaktion eines Tausendfüßlers, vor dem er sich total ekelt. Auch wenn der Autor manchmal hart an der Grenze ist, zu überziehen – der Witz funktioniert. Übrigens schon seit Sonnenblicks Debutroman „Wie ich zum besten Schlagzeuger der Welt wurde und warum“, mit dem er 2009 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert war.
Identitäten zu konstruieren, die nichts mit der Realität zu tun haben, eine Rolle zu spielen, um andere zu beeindrucken – das ist etwas, mit dem Jugendliche wohl sehr viel anfangen können. Mit Zen-Buddhismus möglicherweise erst mal weniger, doch den nehmen sie beim Lesen unangestrengt und unauffällig mit. Indem der Autor die zentralen Inhalte und Aussagen dieser Geisteshaltung ganz selbstverständlich in Dialoge und innere Monologe einfließen lässt, sie an Sans Selbstfindungsprozess aufhängt und vor allem eine Liebesgeschichte darum herum baut, verlieren selbst die demonstrativsten Sprüche ihre Aufdringlichkeit oder Banalität.
Im Original lautet der Titel denn auch „Zen And The Art Of Faking It“. Das trifft den Tonfall und die erzählerische Linie des Buches bedeutend besser als „Buddha-Boy“, wobei die Übersetzung von Gerda Bean durchaus auf dem Punkt ist – Komik in eine andere Sprache zu transportieren, ist bekanntlich keine kleine Herausforderung.
Etwas gut faken zu können, zählt nicht nur in Amerika, in dem der Roman deutlich spürbar spielt, zu hochgeschätzten Fähigkeiten. Sich dieser gesellschaftlich akzeptierten Praxis zu verweigern wiederum gehört zu den Dingen, die eine echte Identität ausmachen. Erzählt uns jedenfalls „Buddha-Boy“.