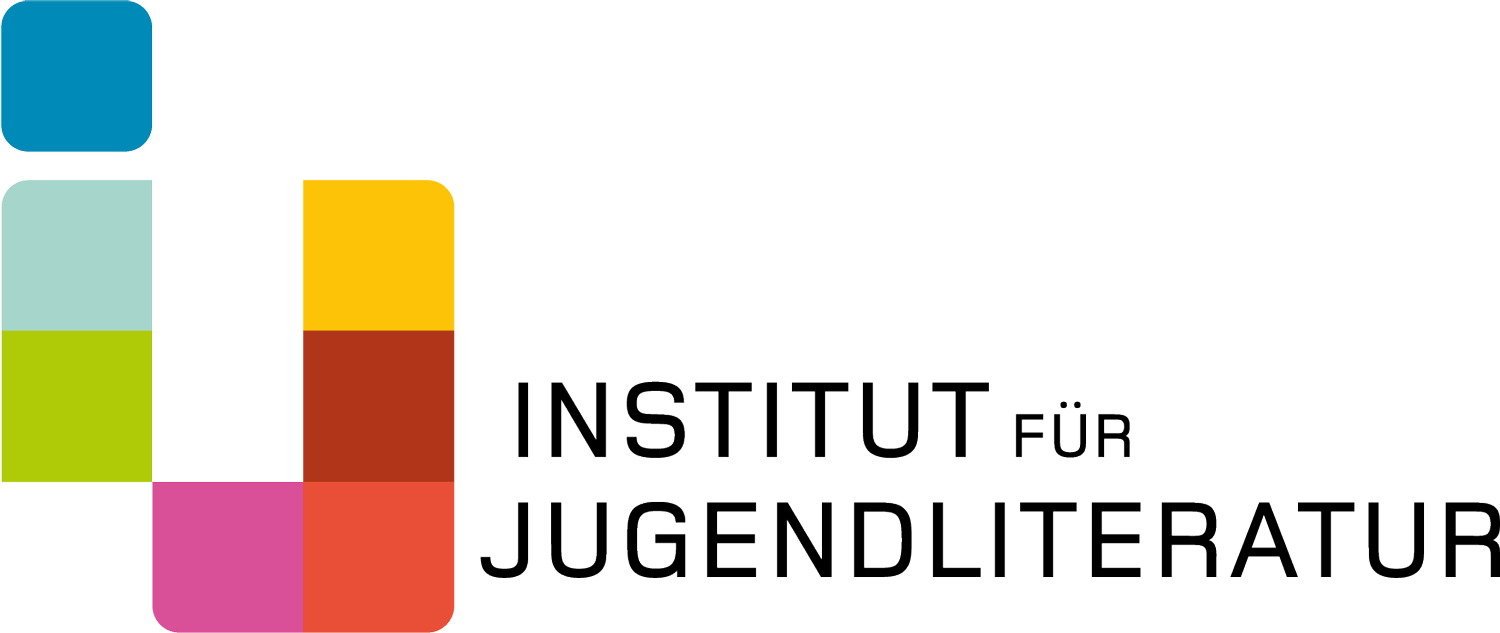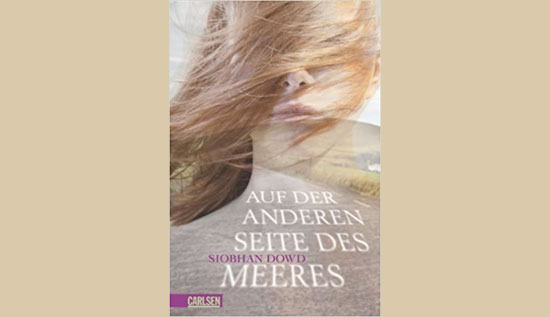
Siobhan Dowd: Auf der anderen Seite des Meeres
Einen Tag vor ihrem fünfzehnten Geburtstag bricht Holly aus der bürgerlich-reglementierten Fürsorge der Aldridges, die sie nach jahrelangem Leben im Heim aufgenommen haben, aus.
Hamburg: Carlsen 2011
Manchmal liest man in Zeitungen über sie, vor allem dann, wenn sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten: über Kinder aus desolaten familiären Verhältnissen, die im Heim landen, bei Pflegefamilien untergebracht werden. Selten jedoch kommen sie selbst zu Wort. In ihrem Roman „Auf der anderen Seite des Meeres“, dem letzten vor ihrem frühen Tod 2007, gibt die irisch-stämmige britische Autorin Siobhan Dowd diesen Kindern eine Sprache. Mit einer Figur, die von der ersten Seite an unter die Haut geht.
Einen Tag vor ihrem fünfzehnten Geburtstag bricht Holly aus der bürgerlich-reglementierten Fürsorge der Aldridges, die sie nach jahrelangem Leben im Heim aufgenommen haben, aus. Setzt sich eine blonde Perücke auf, wird zur älteren und selbstbewussteren „Solace“ und macht sich auf den Weg nach Irland, wo sie ihre Mutter finden will. „Sweet dreams are made of this“, deren Lieblingslied, wird zur Kompassnadel auf Hollys Weg hin zu einer Illusion, von deren realer Entsprechung sie seit Jahren nichts mehr gehört hat und deren Aufenthaltsort sie nicht kennt. Geld hat sie keines, aber dafür eine kindlich anmutende Naivität, die sich mit Durchhaltevermögen und der Fähigkeit, Situationen spontan-klug auszunützen, verbindet. Wenn es sein muss, mit Hilfe von Lügen und Diebstählen. Sie braucht nur ihre Perücke durchzubürsten, den quietschrosa Lippenstift aufzulegen und die hochhackigen Sandalen anzuziehen, dann wird sie zum cleveren Glamour-Girl Solace „mit kerzengeradem Rücken“ und den Tschacka-Tschacka-Hüften. Wobei unter den Kunsthaaren auch immer wieder das verunsicherte, verzweifelte Kind Holly zum Vorschein kommt.
Mit Bus und Bahn, in LKWs und auf Motorrädern trampend schafft sie es tatsächlich bis auf die Fähre, gelangt auf die andere Seite des Meeres. Um dort nicht einmal auszusteigen, weil sich auf der Überfahrt ihre bruchstückhafte Erinnerung zu einem vollständigen Puzzle zusammensetzt und sie realisiert, was damals im „Himmelshaus“ wirklich geschehen ist. Und begreift, dass dort drüben keine Mutter auf sie wartet.
Schon auf ihrem Weg von London durch Wales gehen immer wieder und immer mehr Schubladen mit Erinnerungen auf, die sie in die letzten Winkel ihres Denkens verbannt hat, im Präsens erzählte Retrospektiven, die den Lesenden lange vor der Hauptfigur die Wahrheit erkennen lassen: Dass Bridge Hogan alles andere als eine liebevolle Mutter war, das Himmelshaus nichts weniger als ein geschützter, behüteter Ort.
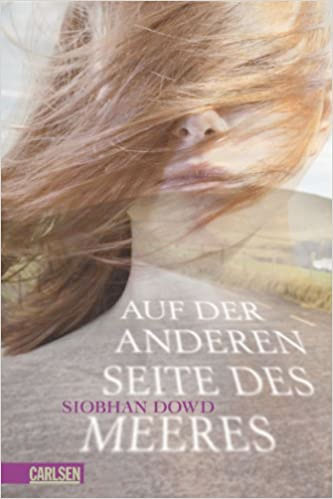
Es hätte aber auch anders kommen können. So wie bei ihren ehemaligen Freunden aus dem Heim, die sie nie wiedersehen wird, wie bei Trim, der „gradlinig wie ein Pfeil vom Heimkind direkt zum Jugendstraftäter wurde“. Einerseits ist es Hollys eigene Tapferkeit und Stärke, die Initiative zu ergreifen und sich ihren Dämonen zu stellen, die sie dazu befähigen, neue Chancen anzunehmen. Andererseits hat sie aber auch irgendwie Glück gehabt, meistens jedenfalls, mit den Menschen, die ihr auf der Reise helfen, „den Netten, die wie Schutzengel waren“, mit ihrem Betreuer, den Pflegeeltern. Die nicht nur die Dinge wahrnehmen, die sie tut, sie nicht als Täterin sehen. Sondern als Opfer einer Kindheit, die ihr den Glauben an Verlässlichkeit und Schutz vollständig geraubt hat, ihr nur Wut, distanziertes Misstrauen und unrealistische Wunschträume als Überlebensstrategien mit auf den Weg gegeben hat.
Dowd zeichnet ihre Figur mit einer Differenziertheit, der man sich nicht entziehen kann. Es sind nicht nur die authentisch wirkenden inneren Monologe und Gedankensplitter, die aussagekräftigen Dialoge, die die Intensität des Eindrucks bewirken, es sind vor allem die vielen unaufdringlichen Details. Wie Holly beiläufig ihre abgekauten Fingernägel betrachtet. Wie sie immer wieder ihre Perücke durchbürstet, wenn es hart auf hart kommt und sie sich selbst wieder einen Schubs geben muss, um weiter zu machen.
„Auf der anderen Seite des Meeres“ ist ein trauriges, berührendes Buch, und dabei ein sehr schönes und tröstliches. Weil es von Mut erzählt und von der Möglichkeit, neu anzufangen. Auch wenn man im elften Stock eines Hochhauses der Hölle viel näher war als dem Himmel.