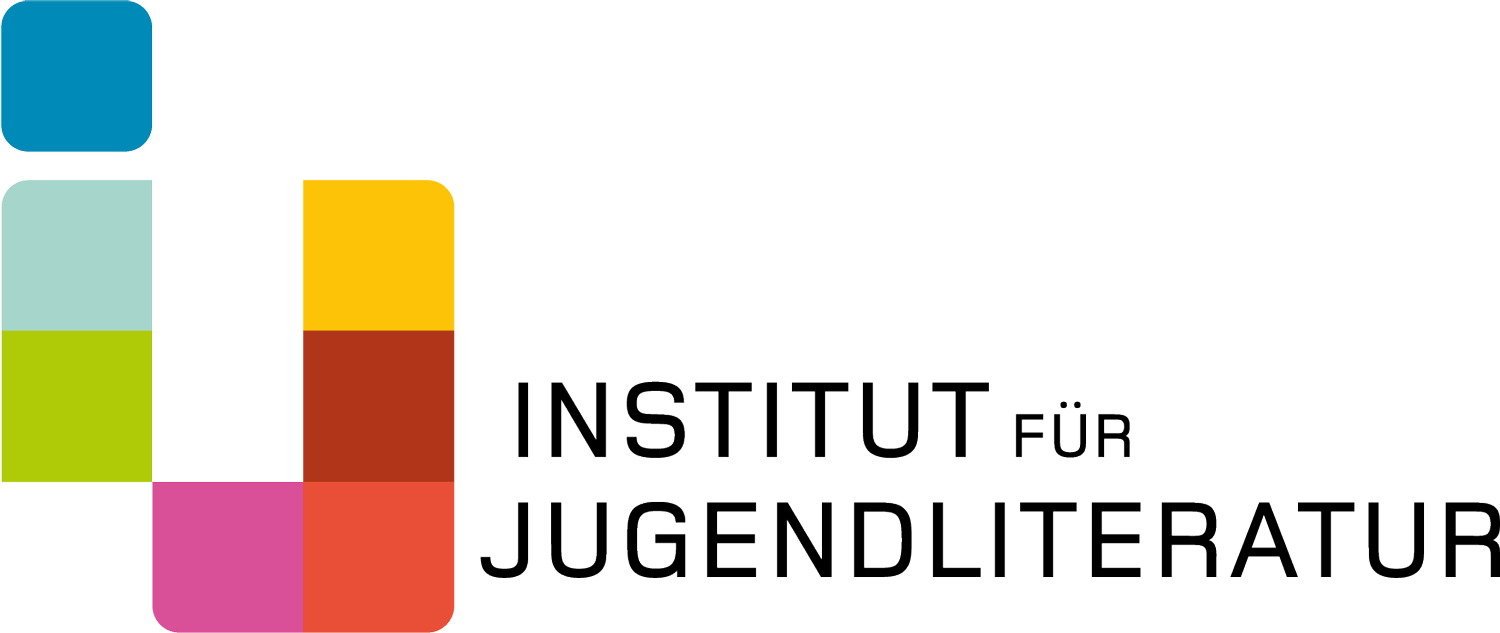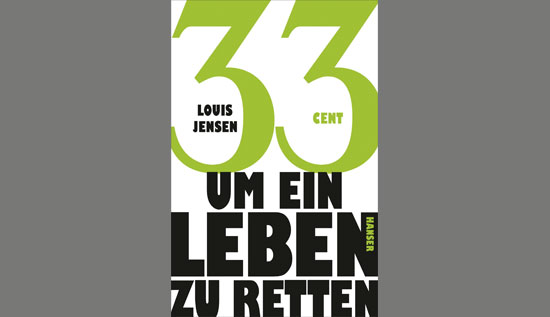
Louis Jensen: 33 Cent – um ein Leben zu retten
„Ist es gerecht, dass Kinder verhungern? Ist das richtig?“ Nachdem er im Fernsehen immer wieder Bilder sterbender Kinder in Afrika sieht, lässt diese Frage den vierzehnjährigen Ich-Erzähler in Louis Jensen´s neuem Jugendroman „33 Cent um ein Leben zu retten“ nicht mehr los.
München: Hanser 2013
„Ist es gerecht, dass Kinder verhungern? Ist das richtig?“ Nachdem er im Fernsehen immer wieder Bilder sterbender Kinder in Afrika sieht, lässt diese Frage den vierzehnjährigen Ich-Erzähler in Louis Jensen´s neuem Jugendroman „33 Cent um ein Leben zu retten“ nicht mehr los. Er beantwortet sie für sich eindeutig mit „nein“ und zieht daraus immer radikalere Konsequenzen.
Um Geld spenden zu können, überweist er zunächst sein Taschengeld, dann geht er nur noch jeden zweiten Tag in die Schule, um im Supermarkt arbeiten zu können, und schließlich beginnt er zu stehlen, um aus der geklauten Ware weiteres Geld zu lukrieren. Sein Verhalten rechtfertigt er vor sich selbst mit zivilem Ungehorsam: „Stehlen ist falsch. Sehr falsch. Ich tue es nur, weil es nötig ist. Wenn etwas sehr nötig ist, dann darf man auch das Falsche tun. Dann ist es richtig, das Falsche zu tun. Dann ist das gerecht.“ Immer besessener werden seine Hilfsaktionen, weil es ja doch nie reicht. Zunächst ist er in seinem Robin Hood-Kampf allein. Freunde hat er keine, und die Erwachsenen sind von dem getriebenen, zweifelnd-verzweifelnden Jugendlichen völlig überfordert. Der engagierte Lehrer ebenso wie der unfähige Schulpsychologe, und die Eltern des namenlos bleibenden Ich-Erzählers sind ohnedies die letzten, bei denen er Hilfe finden könnte. Erstens wird in seiner Familie über Probleme generell nicht gesprochen, und zweitens definiert der Vater Gerechtigkeit gänzlich anders als der Sohn. „Gerecht ist, was im Gesetz steht.“ Er ist, bezeichnenderweise, Richter. In Anne, in die sich der Junge verliebt, findet er schließlich eine Gefährtin, die ihn auf seiner aussichtslosen Mission begleitet, die sogar mit ihm kommt, als er einen Kühlwagen voller Lebensmittel klaut und damit nach Afrika fährt. Zu ihrer eigenen Überraschung schaffen es die beiden wirklich bis dorthin. Doch der Ausgang ist tragisch – das Buch endet so kompromisslos wie die Hauptfigur agiert.
Der reduzierte Text, der sich in kurzen und Kürzest-Kapiteln präsentiert, ist keine leichte Kost. Er konfrontiert von Beginn an mit sehr komplexen moralischen Fragestellungen nach Recht und Gerechtigkeit, richtig und falsch, bezieht sich auf die großen Orientierungs-markierungen der christlichen Religion ebenso wie auf klassische literarische Stoffe: „Mein Kampf ist gerecht. Johannes der Täufer und Jesus und Robin Hood halten zu mir.“
Über die zwischen dem Gesetz Kreons und dem Gesetz der Götter stehende Antigone wird ebenso reflektiert wie über die Frage nach der Gerechtigkeit von Gesetzen im historischen Kontext. Etwa darüber, dass es während der Nazi-Besatzung – die Geschichte spielt in Dänemark – verboten war, den Juden zu helfen, und es dennoch richtig war, es zu tun.
Das Buch erfordert einen Lesenden, der sich von inhaltlichen Sprüngen nicht aus dem Konzept bringen lässt und es auch aushält, wenn ein Kapitel ausschließlich aus den Sonderangeboten im Supermarkt besteht: 432, 56 Euro. Ein Tag lang Essen für 1310 Kinder. 33 Cent als neue Währungseinheit, Geld wird in Kinderleben umgerechnet.
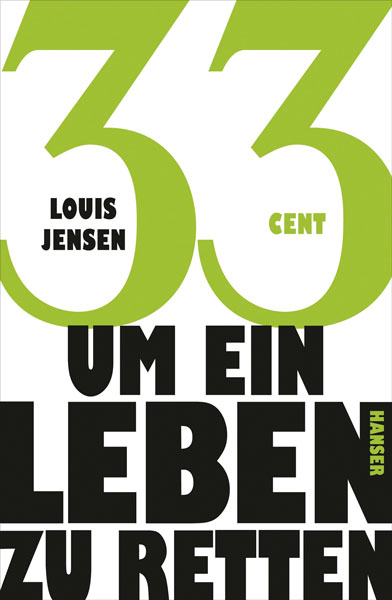
„33 Cent um ein Leben zu retten“ ist ein herausforderndes, unbequemes Buch über den Idealismus eines Einzelnen, der nicht nur in seiner überzogenen Radikalität zum Scheitern verurteilt ist, sondern vor allem durch das Ausblenden von Zusammenhängen, die hinter dem Problem liegen. Denn an einem lässt Jensen keinen Zweifel: Weder Gesetz noch Gerechtigkeit sind losgelöst von dem Kontext, in dem sie stehen.