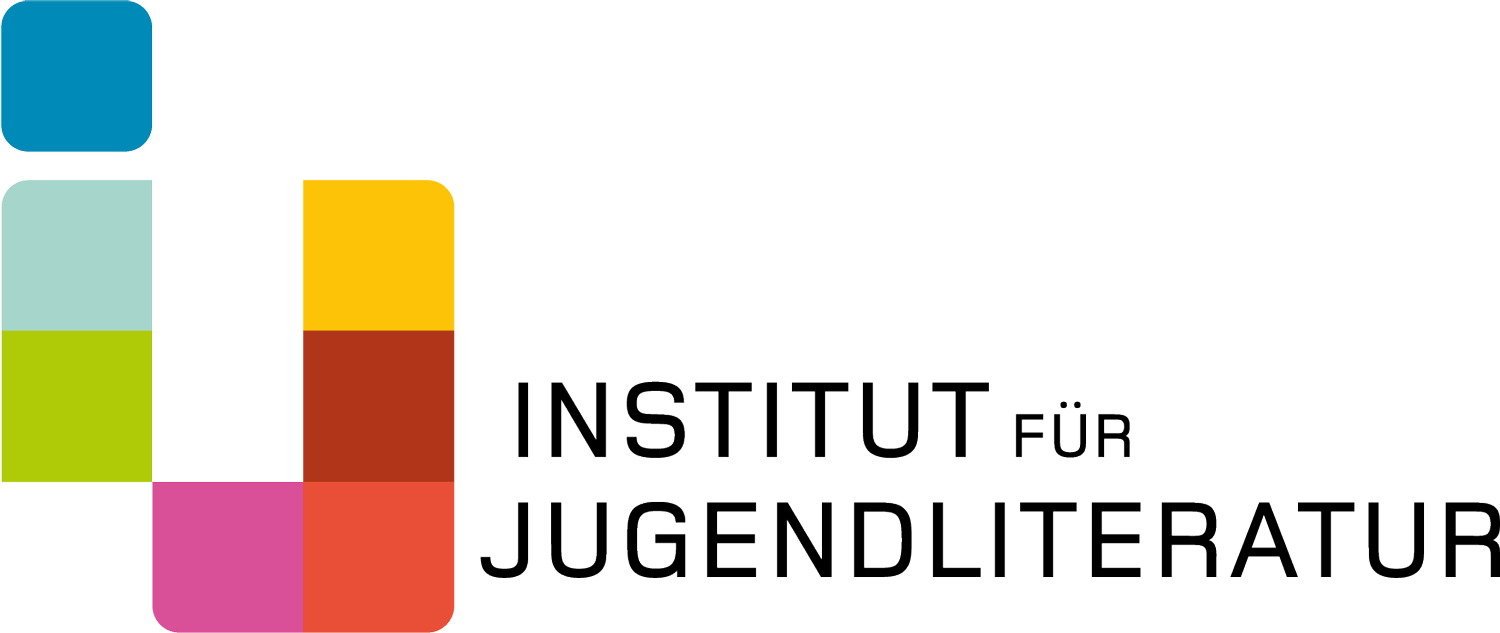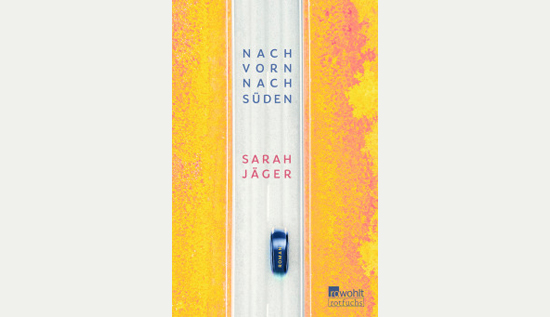
Nach vorn, nach Süden
Spannende Charaktere, pointenreiche Dialoge und komische Situationen ... Es ist ein ausgesprochenes Vergnügen, „Nach vorn, nach Süden“ zu lesen.
Dabei zu sein heißt noch lange nicht, dazu zu gehören. Die Ich-Erzählerin in Sarah Jägers Debutroman „Nach vorn, nach Süden“ hängt zwar mit den anderen Aushilfen am Hinterhof des Penny Markts ab, aber keiner hebt den Kopf, wenn sie ankommt. „Nicht jeder wird im Hinterhof vermisst.“ Einen ganz anderen Auftritt haben die Hauptdarsteller in diesem grau betonierten Quadrat mit den Holzpaletten und Müllcontainern. Can, der immer der Erste ist, den man sieht. „Es gibt ja so Menschen. Die kommen in den Raum, und alles wirft Funken.“ Marie, die alle mögen, weil sie einfach sie selbst ist, offen, warmherzig, und ziemlich hübsch noch dazu. Vika, die schon ein Kind von Otto hat, zusammen sind sie zwar nicht mehr, aber dass sie beide zum und in den Hinterhof gehören, steht außer Frage. So wie Leroy, Marvin, Pawel, der nur „unser Pawel“ heißt. Während die Ich-Erzählerin von allen Entenarsch gerufen wird, auch von Can, in den sie unentdeckt und unglücklich verliebt ist.
Es ist ein ausgesprochenes Vergnügen, „Nach vorn, nach Süden“ zu lesen. Sarah Jäger gibt der Erzählerin eine glaubhafte Stimme, hat großes Talent für spannende Charaktere, für Schauplätze, pointenreiche Dialoge und komische Situationen. Beispielsweise jene, als der Führerscheinneuling kundtut, dass sie keine Autobahn fährt. „ Du, das wird schwierig. Wir stehen mitten in der Auffahrt.“ versucht Marie an meinen gesunden Menschenverstand zu appellieren. (…) „Can schlägt mit der flachen Hand gegen das Autodach und Marie zuckt zusammen. Ich bin mir sicher, er würde gerne mit einem Satz aus dem Auto springen, aber mein Corsa ist nur ein Dreitürer. Augen auf bei der Sitzplatzwahl, möchte ich rufen, aber ich kann gerade nicht reden. Ich kann nur nach vorn starren und das Lenkrad festhalten.“
Nebenstraßen also. So wie sich die Ich-Erzählerin auch nicht geradlinig nach vorn, sondern auf Umwegen weiterentwickelt. Sich selbst und den anderen gegenüber unbequeme Wahrheiten, ihren Beitrag zur Trennung von Marie und Jo, eingesteht. Immer mehr erkennt, dass es auch an ihr liegt, etwas an ihrer Beziehung zu den anderen zu ändern. Und schließlich ihren eigenen Weg findet. „Ich kann nicht über Scherben steigen und so tun, als wäre nichts, einfach so mit den anderen nach Italien fahren, als ginge es nicht darum, Jo zu finden, mit den anderen in die falsche Richtung rennen, nur um dabei zu sein, wenn alle in die falsche Richtung rennen, dann ist das ja schon oft genug schiefgegangen, und wenn man spürt, dass etwas falsch ist, dann muss man aufhören, dabei zu sein, dann muss man einen anderen Weg gehen oder hüpfen oder springen oder watscheln, wonach einem gerade ist, und dann muss man auch aushalten, dass es weh tut. Es wird weh tun, und ich muss das aushalten.“ Es wird sich auszahlen. Am Ende führt ihr Weg zum Hinterhof zurück, und sie wird nicht mehr Entenarsch sein, sondern zum ersten Mal in diesem Text Lena.
Die Autorin, die auch Literaturbloggerin und Buchhändlerin ist, erzählt ihre Version einer jugendliterarischen road novel in einem sehr originären Tonfall, der dicht am Zielpublikum dran zu sein scheint, setzt in den Dialogen Jugendsprache ein, ohne dass sie aufgesetzt wirkt. Die schonungslos lakonische Erzählerinnen-Stimme stellt sich selbst sehr differenziert dar; ihre Außenseiterposition hat vorwiegend mit ihr selbst zu tun, mit ihrer angstbedingten Zurückhaltung, mit unpassenden Wortmeldungen, für die sie keine Sympathiepreise gewinnt. „Ach Entenarsch“, seufzt Can. (…) „Das war so klar. Immer den Finger in die Wunde legen.“ Unter der temporeichen Handlungsoberfläche schimmern unaufdringlich Reflexionen über Gruppensysteme, Gruppendynamik und die Frage der eigenen Positionierung im Gefüge durch – dazu zu gehören, nicht nur dabei zu sein, bedeutet auch, selbst die Richtung mit zu bestimmen.