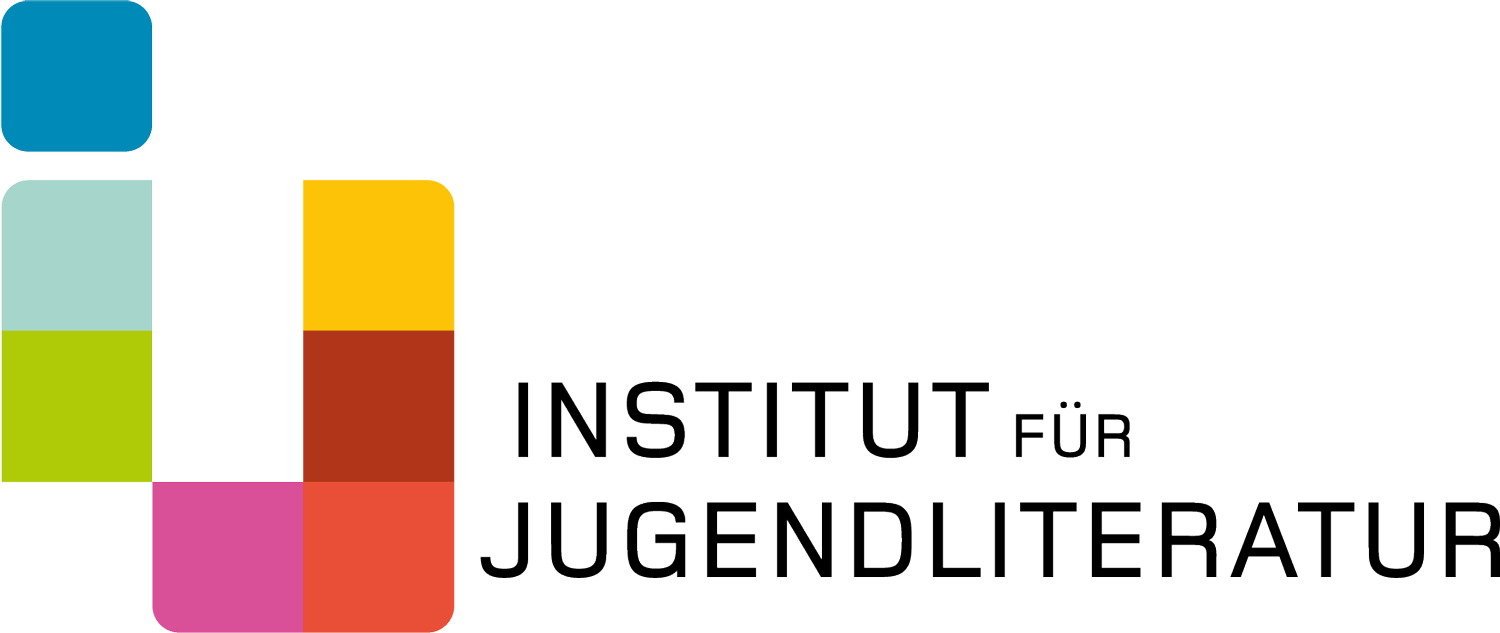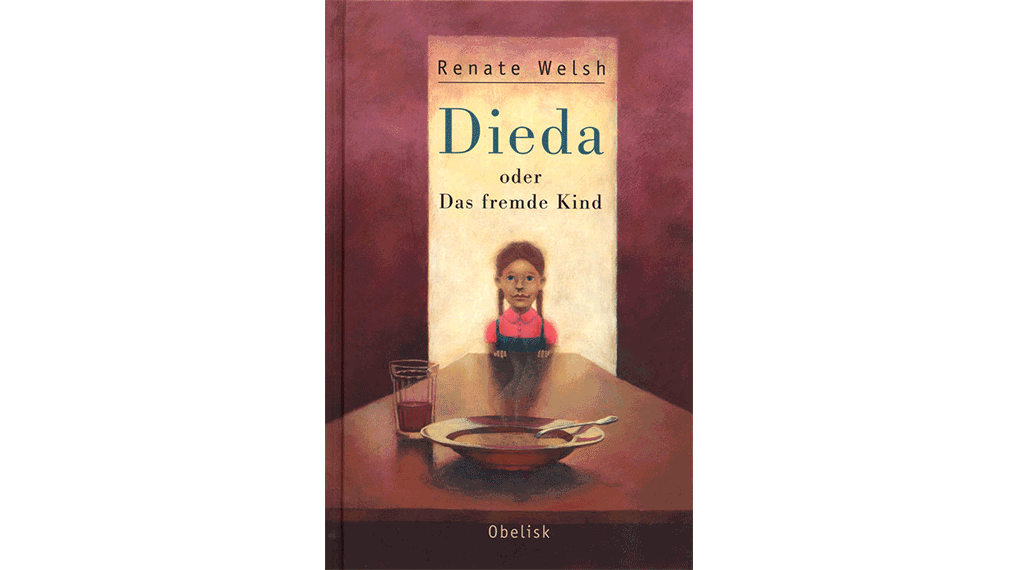
Dieda oder das fremde Kind
Renate Welsh (2003)
Preisgekrönt 2003: Dieda oder das fremde Kind
Sprachlich beeindruckender Roman aus dem letzten Kriegsjahr um das einsame Leben einer Halbwaise auf dem Land. Von dem in Wien zurückgebliebenen Vater getrennt, begreift das sensible Mädchen sich als Fremde in ihrer neuen Stieffamilie und reagiert nur mehr auf den unpersönlichen Namen „Die-da“. Erst die Rückkehr nach Wien und die Geburt ihrer Halbschwester ermöglichen eine Annäherung.Rezension aus dem Jahr 2002
Von Pippi Langstrumpf über die Rote Zora bis hin zu Nöstlingers Austauschkind reicht die Tradition des fremden Kindes in der Kinderliteratur. Renate Welsh verschiebt in ihrer Erzählung die motivischen Rahmenbedingungen: Die Protagonistin selbst ist es, die sich auf Grund der neuen Lebensumstände als fremdes Kind begreift. Ein ehemaliger Ort der Vertrautheit und des sommerlichen Glücks verwandelt sich durch familiäre Verschiebungen in einen Ort der Selbstentfremdung: Nach dem Tod der Mutter vom Vater getrennt (der Arzt bleibt im Wien des zu Ende gehenden Zweiten Weltkrieges zurück) und nunmehr in den Familienverband von dessen zweiter Frau gestellt, erlebt die Heldin das ehemalige Feriendomizil am Land unter geänderten Voraussetzungen: Kein Mitleid soll dem Kind entgegengebracht werden – Menschen, die eine gemeinsame Vergangenheit mit ihm haben, werden bewusst aus dem neuen Familienverband ausgegrenzt. Renate Welsh transferiert die berührende Lebenssituation einer Anna Wimschneider auf die Wahrnehmungsebene eines Kindes: Ebenso karg und geradlinig, wie die bayrische Bäuerin die Lebensverhältnisse im fremden Familienverband des Ehemannes in "Herbstmilch" beschrieben hat, wird hier von sozialem Druck und emotionaler Vereinsamung erzählt. Ihrer Fremdheit gibt die kindliche Protagonistin einen Namen, indem sie nur noch auf ein unpersönliches "Die-da" reagiert. Ganz der kindlichen Perspektive verpflichtet, schildert Renate Welsh kleine, alltägliche Szenen der Ausgrenzung. Erinnerungen an die leibliche Mutter, deren Krankheit und Tod werden durch diese kindliche Perspektive ebenso fragmentarisch gehalten wie die historisch-politische Situation. Niemand ist bereit, Dieda jene Dinge zu erklären, die sie aufschnappt oder beobachtet. Ein einziges Mal nur ist es Dieda möglich, zur Nachbarin zu entfliehen und Hilfestellung in ihrer ersten kindlich-sexuellen Verunsicherung zu erbitten. Dominiert wird das Leben vom "Alten", von dessen Regeln der Ungleichbehandlung, von dessen strenger, schlagender Hand. Erst als die neue Mutter sichtbar ein Kind erwartet und mit Dieda nach Wien zurückkehrt, zeigen sich emotionale Schlupflöcher und punktuelle Möglichkeiten der Annäherung. Sensibel und genau formuliert Renate Welsh und umkreist in personaler Sicht die scheinbaren Nebensächlichkeiten, die doch stets so nachhaltige Wirkung haben. (Heidi Lexe)
In: "1001 Buch" | 2002, Heft 4, S. 57